Angélique befand sich wie gewöhnlich in der Küche. Um sie herum spielten Denis, Marie-Agnès und der kleine Albert. Der Letztgeborene lag in seiner Wiege neben dem Herd. Nach Ansicht der Kinder war die Küche der schönste Raum im Hause. Das Feuer brannte ohne Unterbrechung und fast ohne Rauch, denn der Rauchfang des riesigen Kamins war sehr hoch. Der Schein dieses ewigen Feuers tanzte und spiegelte sich auf dem roten Grunde der kupfernen Kasserollen und Wannen, die die Wände garnierten.
An diesem Abend bereitete Angélique eine Hasenpastete zu. Sie hatte gerade den Teig in Tortenform gebracht und schnitt das Fleisch klein, mit dem er belegt werden sollte. Fantine, die ihr behilflich war, brummte mit argwöhnischer Miene: »Was soll das eigentlich, mein Herzchen? Es ist nicht deine Art, dich um den Haushalt zu kümmern. Findest du am Ende, daß meine Gerichte nicht mehr gut genug sind?«
»Doch, aber man muß auf alles vorbereitet sein.«
»Wieso?«
»Heute nacht«, sagte Angélique, »habe ich geträumt, ich sei Dienstmagd und koche für Kinder. Das hat mir Spaß gemacht, denn ihre kleinen Fratzen waren um den Tisch versammelt und schauten mich aus leuchtenden Augen an. Was soll ich denn tun, wenn ich Dienstmagd werde und unfähig bin, Kuchen für die Kinder meiner Herrschaft zu backen?«
»Wie kannst du dir nur so etwas ausdenken!« rief die Amme ehrlich entrüstet aus. »Du wirst niemals Dienstmagd sein, da du die Tochter von Edelleuten bist. Du wirst einen Baron oder einen Grafen heiraten ... vielleicht gar einen Marquis?« fügte sie lachend hinzu.
Raymond, der im Herdwinkel las, hob den Kopf.
»Deine Zukunftspläne machen sich, wie ich sehe. Man hatte mir gesagt, du wollest Räuberhauptmännin werden?«
»Das eine schließt das andere nicht aus«, erwiderte sie und knetete dabei energisch ihren Fleischteig weiter.
»Hör mal, Angélique, du solltest keine solch ... solch lästerlichen Dinge erzählen!« erklärte plötzlich die gute Pulchérie, die ebenfalls in der Küche Zuflucht suchte, weniger um der Kälte des Salons als den bissigen Bemerkungen ihrer Schwester zu entrinnen.
»Aber ich glaube nicht, daß Angélique so ganz und gar unrecht hat«, sagte Raymond gemessen. »Eine der größten Sünden auf Erden ist der Hochmut, und man sollte keine Gelegenheit auslassen, ihn zu bekämpfen. Sich also erniedrigen und Dienstbotenarbeiten verrichten ist dem Herrn bestimmt wohlgefällig.«
»Du redest Unsinn«, erklärte Angélique bündig. »Ich will mich gar nicht erniedrigen. Ich will einfach fähig sein, Kuchen für Kinder zu backen, die ich gern habe. Wirst du sie essen, Marie-Agnès? Und du, Denis?«
»Ja, ja«, riefen die beiden Kleinen und liefen herzu.
Von draußen vernahm man den Hufschlag eines Pferdes.
»Da kommt euer Vater zurück«, sagte Tante Pulché-rie. »Angélique, ich meine, es wäre schicklich, daß wir im Salon erschienen.«
Doch nach einer kurzen Stille, während deren der Reiter abgestiegen sein mußte, ertönte die Glocke des Portals.
»Ich gehe«, rief Angélique. Sie stürzte davon, ohne an ihre über die mehlbestäubten Arme gekrempelten Ärmel zu denken.
Durch den Regen und den abendlichen Dunst hindurch erkannte sie einen großen, hageren Mann, dessen Umhang vor Nässe triefte.
»Habt Ihr Euer Pferd untergestellt?« rief sie. »Hier erkälten sich die Tiere schnell. Wir haben zuviel Nebel wegen des Moors.«
»Ich danke Euch, Fräulein«, erwiderte der Fremde, indem er seinen breiten Hut abnahm und sich verneigte. »Ich habe mir nach dem Brauch der Reisenden erlaubt, sogleich mein Pferd und mein Gepäck in Euern Stall zu bringen. Da ich mich heute abend von meinem Ziel noch weit entfernt befinde und am Schloß Monteloup vorüberkam, wollte ich für eine Nacht die Gastfreundschaft des Herrn Barons erbitten.«
Aus dem nur mit einem schmalen weißen Kragen besetzten Gewand aus grobem schwarzem Stoff schloß Angélique auf einen Krämer oder einen Bauern im Sonntagsstaat. Freilich verwirrte sie sein Akzent, der nicht der Dialekt des Landes war und ein wenig fremdländisch klang, und überdies die Gewähltheit seiner Rede.
»Mein Vater ist noch nicht zurück, aber setzt Euch nur ans Feuer in die Küche. Ich werde einen Knecht in den Stall schicken, um Euer Pferd zu füttern.«
Sie ging voraus und geleitete den Gast in die Küche, wo eben ihr Bruder Josselin durch die Gesindetür eingetreten war. Kotbespritzt, mit gerötetem und verschmutztem Gesicht, hatte er ein mit dem Wurfspieß erlegtes Wildschwein hinter sich her gezogen.
»Gute Jagd, mein Herr?« fragte der Fremde in höflichstem Ton.
Josselin warf ihm einen unfreundlichen Blick zu und antwortete nur mit einem Brummlaut. Dann setzte er sich auf einen Hocker und streckte die Füße ans Feuer. Bescheiden ließ sich der Gast ebenfalls im Herdwinkel nieder und nahm einen Teller Suppe in Empfang, den Fantine ihm reichte.
Er erklärte, er sei in dieser Provinz beheimatet und in der Gegend von Secondigny geboren, aber da er viele Jahre auf Reisen verbracht habe, vermöge er nun seine eigene Sprache nur noch mit einem starken Akzent zu sprechen. Allerdings werde sich das rasch geben, versicherte er: erst vor einer Woche nämlich sei er in La Rochelle an Land gegangen.
Bei diesen letzten Worten hob Josselin den Kopf und starrte den Fremden mit leuchtenden Augen an.
Die Kinder kamen näher und überschütteten ihn mit Fragen.
»In welchem Land seid Ihr gewesen?«
»Ist es weit?«
»Was für einen Beruf übt Ihr aus?«
»Ich habe keinen Beruf«, erwiderte der Unbekannte. »Für den Augenblick wird es mir, denke ich, genügen, Frankreich zu durchqueren und jedem, der mir zuhören mag, meine Abenteuer und Reisen zu erzählen.«
»Wie die fahrenden Sänger, die Troubadours früherer Zeiten?« fragte Angélique, die immerhin einiges von Tante Pulchéries Unterricht behalten hatte.
»So ungefähr, obwohl ich mich weder auf das Singen noch auf das Versemachen verstehe. Aber ich könnte wunderschöne Dinge über jene großen Ebenen erzählen, wo man, um ein Pferd zu bekommen, nur hinter einem Felsen das Vorbeiziehen der wilden Herden zu erspähen braucht, die mit den Nüstern gegen den Wind dahingaloppieren. Man wirft ein langes Seil mit einer Schlinge aus und zieht sein Tier heran.«
»Läßt es sich leicht zähmen?«
»Nicht immer«, sagte der Gast lächelnd. Und Angélique erfaßte plötzlich, daß dieser Mann wohl selten lächelte. Er schien um die Vierzig zu sein, aber es lag etwas Jähes und Leidenschaftliches in seinem Blick.
»Fährt man denn wenigstens über das Meer, um in jene Länder zu gelangen?« fragte argwöhnisch der wortkarge Josselin.
»Man überquert den ganzen Ozean. Dort drüben, im Innern der Länder, gibt es Flüsse und Seen. Die Bewohner haben eine kupferrote Hautfarbe. Sie schmücken ihre Köpfe mit Vogelfedern und fahren in Booten aus zusammengenähten Tierhäuten. Ich bin auch auf Inseln gewesen, wo die Menschen vollkommen schwarz sind. Sie nähren sich von Schilf, das so dick wie ein Arm ist und das man Zuckerrohr nennt, und von dorther kommt tatsächlich der Zucker. Man stellt aus diesem Sirup auch ein Getränk her, das stärker als der Kornbranntwein ist, das aber weniger trunken macht und Kraft und Übermut verleiht: den Rum.«
»Habt Ihr von diesem wunderlichen Getränk etwas mitgebracht?« fragte Josselin.
»Ich habe ein Fläschchen in meiner Satteltasche. Aber ich habe mehrere Fässer bei meinem Vetter gelassen, der in La Rochelle wohnt und sich ein gutes Geschäft davon verspricht. Ich selbst bin kein Handelsmann. Ich bin nur ein Reisender, der sich nach neuen Ländern sehnt, der jene Gegenden kennenlernen möchte, wo niemand weder Hunger noch Durst kennt und wo der Mensch sich frei fühlt. Ebendort habe ich erkannt, daß alles Übel vom weißen Menschen kommt, weil er nicht auf das Wort des Herrn gehört, vielmehr es verfälscht hat. Denn der Herr hat nicht befohlen zu töten noch zu zerstören, sondern sich untereinander zu lieben.«
Es wurde still. Die Kinder waren an eine solche Sprache nicht gewöhnt ...
»Das Leben in Amerika ist also vollkommener als in unseren Ländern, wo Gott schon so lange regiert?« fragte plötzlich die ruhige Stimme Raymonds.
Auch er war näher gerückt, und Angélique entdeckte in seinem Blick einen Ausdruck, der demjenigen des Fremden entsprach.
»Ihr seid Protestant, nicht wahr?«
»Ganz recht. Ich bin sogar Priester, wenn auch ohne Gemeinde, und vor allem Reisender.«
»Nun, ich kann schwerlich mit Euch über religiöse Dinge diskutieren«, sagte Josselin, »denn ich vergesse allmählich mein Latein. Aber mein Bruder spricht es flüssiger als Französisch und .«
»Das ist ja gerade einer der größten Übelstände in unserm Frankreich«, rief der Pastor aus. »Daß man nicht mehr zu seinem Gott, was sage ich: zum Gott der Welten, in seiner Muttersprache und mit seinem Herzen beten kann, sondern daß es unumgänglich ist, sich lateinischer Zauberformeln zu bedienen .«
Angélique bedauerte, daß nicht mehr von Springfluten, Sklavenschiffen und unheimlichen Tieren die Rede war. Sie rückte unruhig auf ihrem Platz hin und her, und dabei entging es ihr, daß die Amme den Raum verließ. Fantine lehnte die Tür nur an, und man hörte sie flüstern und darauf die Stimme Madame de Sancés, die annahm, daß man sie nicht verstehen könne.
»Protestantisch oder nicht, meine Gute, dieser Mann ist unser Gast und wird es bleiben, solange es ihm beliebt.«
Kurz darauf trat die Baronin, gefolgt von Hortense, in die Küche.
Der Besucher verbeugte sich sehr höflich, jedoch ohne Handkuß und ohne die höfische Reverenz. Angélique sagte sich, daß er gewiß ein Bürgerlicher sei, aber gleichwohl sympathisch, wenn auch Hugenotte, und ein klein wenig exaltiert.
»Pastor Rochefort«, stellte er sich vor. »Ich muß mich nach Secondigny begeben, wo ich geboren bin, aber da der Weg weit ist, wollte ich mich gerne unter Eurem gastlichen Dach ausruhen, gnädige Frau.«
Die Hausherrin versicherte ihm, er sei willkommen. Sie alle seien strenge Katholiken, was aber nicht hindere, tolerant zu sein, wie der gute König Heinrich IV. es anempfohlen habe.
»Eben dies habe ich zu hoffen gewagt, als ich hier eintrat, Madame«, hob der Pastor wieder an, indem er sich tiefer verbeugte, »denn ich muß Euch gestehen, daß mir Freunde anvertrauten, Ihr hättet seit langen Jahren einen alten hugenottischen Diener. Ich habe ihn zuvor aufgesucht, und eben dieser Wilhelm Lützen ist es, der mich hat hoffen lassen, Ihr würdet mich für heute nacht aufnehmen.«
»Ihr könnt dessen tatsächlich versichert sein, Monsieur, und auch die nächsten Tage, wenn es Euch Vergnügen macht.«
»Mein einziges Vergnügen besteht darin, den Geboten des Herrn zu folgen und ihm nach bestem Vermögen zu dienen. Und Er ist es, der mich hierher führt, denn ich will Euch gestehen, daß ich vor allem Euren Gatten sprechen möchte .«
»Ihr habt eine Bestellung für meinen Mann?« verwunderte sich Madame de Sancé.
»Keine Bestellung, aber vielleicht einen Auftrag. Vergönnt mir, gnädige Frau, daß ich nur ihm selbst Mitteilung davon mache.«
»Gewiß, Monsieur. Übrigens höre ich die Schritte seines Pferdes.«
Wirklich trat gleich darauf Baron Armand ein. Offenbar hatte man ihn von dem überraschenden Besuch schon verständigt, denn er bezeigte seinem Gast nicht die gewohnte Herzlichkeit. Er wirkte gezwungen und fast ängstlich.
»Ist es wahr, Herr Pastor, daß Ihr aus Amerika kommt?« erkundigte er sich nach den üblichen Begrüßungen.
»Jawohl, Herr Baron. Und ich wäre froh, wenn ich mit Euch ein paar Augenblicke unter vier Augen über eine Euch bekannte Angelegenheit sprechen könnte.«
»Pst!« machte gebieterisch Armand de Sancé und warf einen beunruhigten Blick zur Tür. Etwas überstürzt fügte er hinzu, sein Haus stehe Monsieur Rochefort zur Verfügung, dieser möge nur bei den Stubenmädchen alles anfordern, was zu seiner Bequemlichkeit nötig sei. In einer Stunde werde man zur Nacht speisen.
Der Pastor dankte und bat um Erlaubnis, sich einstweilen zurückziehen zu dürfen, um sich ein wenig zu säubern. Als der Gast jedoch auf die Tür zuschritt, um sich nach dem Zimmer zu begeben, in das Madame de Sancé ihn zu führen im Begriff war, hielt ihn Josselin in seiner gewohnt brüsken Art am Arm fest.
»Ein Wort noch, Pastor. Um in jenen Ländern Amerikas zu arbeiten, muß man wohl sehr reich sein oder doch ein Fähnrichspatent oder eins für irgendein Handwerk kaufen?«
»Mein Sohn, Amerika ist ein freies Land. Es wird dort nichts verlangt, wenn es auch erforderlich ist, viel und hart zu arbeiten und seinen Mann zu stehen.«
»Wer seid Ihr, Fremdling, daß Ihr Euch erlaubt, diesen jungen Mann Euren Sohn zu nennen, und solches in Gegenwart seines Vaters und seines Großvaters?« ließ sich da von der Tür her der alte Baron mit höhnischer Stimme vernehmen.

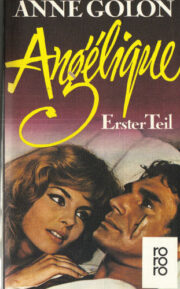
"Angélique" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique" друзьям в соцсетях.