Angélique sah aus der Entfernung, wie ihr Vater sein großes Taschentuch hervorzog und sich die Stirn wischte. »Er wird nichts erreichen«, sagte sie sich mit wehem Herzen. »Was kümmert’s sie schon, wenn wir Sorgen mit unseren Mauleseln und unserem silberhaltigen Blei haben?«
Sie entfernte sich und betrat den Park, über den sich der blaue Abend breitete. Noch immer hörte man in den Salons die Violinen und Gitarren einander antworten, und in langer Reihe brachten Lakaien die Leuchter. Einige stiegen auf Schemel und entzündeten die an den Wänden angebrachten Kerzen.
»Wenn ich denke«, sagte sich Angélique, während sie langsam durch die Alleen wanderte, »daß der arme Papa sich wegen der paar Maultiere Skrupel machte, die Molines in Kriegszeiten gern nach Spanien verkauft hätte! Verrat? Das ist all diesen Fürsten höchst gleichgültig, die dennoch nur durch die Monarchie leben. Kann man es sich vorstellen, daß sie ernstlich die Absicht haben, den König zu bekämpfen?«
Sie war um das Schloß herumgegangen und befand sich jetzt an seiner Rückseite, am Fuße jener Fassade, die sie früher so oft erklettert hatte, um die Schätze des Wunderzimmers zu betrachten. Der Ort war verlassen, denn die Paare, die die an diesem Herbsttag schon recht kühle Abendluft nicht scheuten, hielten sich zumeist auf dem Rasen vor der Vorderfront auf.
Ein vertrauter Kindheitsinstinkt veranlaßte sie, ihre Schuhe auszuziehen, und behende schwang sie sich trotz ihres langen Kleides auf das Kranzgesims des ersten Stockwerks hinauf. Es war jetzt vollkommen Nacht, und kein Vorbeikommender hätte sie bemer-ken können, zumal sie sich an ein Türmchen preßte, das den rechten Flügel des Schlosses zierte.
Das Fenster stand offen. Angélique beugte sich vorsichtig hinein. Der Raum schien zum erstenmal bewohnt zu sein, denn sie erkannte den goldenen Schimmer eines Öl-Nachtlämpchens. Das Mysterium der schönen Möbel und Tapeten wurde dadurch nur noch tiefer. Wie Schneekristalle funkelte das Perlmutt eines Nähtischchens aus Ebenholz.
Als Angélique in die Richtung des hohen, damastverkleideten Bettes schaute, hatte sie plötzlich das Gefühl, als habe sich das Bild des Gottes und der Göttin belebt.
Zwei weiße, nackte Körper umschlangen sich dort auf den in Unordnung geratenen Leintüchern, deren Spitzen auf den Boden hinabhingen. Sie waren so eng ineinander verschlungen, daß Angélique zunächst an einen Ringkampf zwischen rauflustigen und schamlosen Jünglingen dachte, bis sie erkannte, daß dort ein Mann und eine Frau lagen.
Das blonde, lockige Haar des Mannes bedeckte fast völlig das Gesicht der Frau, die sein langer Körper völlig zerdrücken zu wollen schien. Gleichwohl bewegte er sich sanft, regelmäßig, von einer Art wollüstiger Hartnäckigkeit beseelt, und der Widerschein der Nachtlampe offenbarte das Spiel seiner herrlichen Muskeln.
Von der Frau erkannte Angélique nur da und dort einen aus dem Halbdunkel hervortauchenden Schimmer: ein gegen den männlichen Körper erhobenes zartes Bein, eine zwischen den sie umschlingenden Armen hervorquellende Brust, eine leichte weiße Hand. Diese kam und ging wie ein Schmetterling, streichelte gleichsam mechanisch die Flanke des Mannes, um dann plötzlich kraftlos herabzufallen, während ein tiefer Seufzer von den Pfühlen aufstieg.
In den Augenblicken der Stille vernahm Angélique die sich vermischenden und immer rascher werdenden Atemzüge, dem Wehen eines heißen Sturmes gleich. Dann brachte eine plötzliche Entspannung die Beruhigung. Und das Ächzen der Frau erklang von neuem in der Finsternis, während ihre Hand besiegt auf das weiße Leintuch fiel wie eine abgeschnittene Blume.
Angélique war fassungslos und zugleich unbestimmt verwundert. Nachdem sie so oft das Bild des Olymps betrachtet, seine frische Lebendigkeit und seinen majestätischen Schwung genossen hatte, war es letzten Endes ein Eindruck von Schönheit, den ihr diese Szene vermittelte, deren Bedeutung sie als Landmädchen erfaßte.
»Das also ist die Liebe«, sagte sie sich, während sie ein Schauer des Entsetzens und der Lust durchfuhr.
Endlich lösten sich die beiden Liebenden. Sie lagen nun nebeneinander und ruhten wie Grabmalsstatuen im Dunkel einer Krypta. Weder er noch sie sprach ein Wort. Die Frau regte sich zuerst. Sie streckte ihren sehr weißen Arm aus und nahm von der Konsole nahe dem Bett eine Flasche, in der rubinroter Wein schimmerte. Sie ließ ein mattes, kleines Lachen hören.
»Oh, Geliebter, ich bin wie zerschlagen«, flüsterte sie. »Wir müssen unbedingt zusammen diesen Roussillonwein trinken, den Euer vorausblickender Diener hier bereitgestellt hat. Wollt Ihr einen Schluck?«
Aus dem Grunde des Alkovens antwortete der Mann mit einem Brummen, das als Zustimmung gedeutet werden konnte. Die Dame, deren Kräfte zurückgekehrt zu sein schienen, füllte zwei Gläser, reichte eines ihrem Liebhaber und trank das andere mit genießerischer Lust.
»Das ist die Brautsuppe der Fürsten«, dachte Angélique. Sie hatte kein Empfinden für ihre unbequeme Stellung. Jetzt konnte sie die Frau deutlich sehen, und sie bewunderte ihre vollendet runden Brüste, ihren geschmeidigen Leib, ihre langen, gekreuzten Beine.
Auf dem Tablett lagen Früchte. Die Frau wählte einen Pfirsich und biß herzhaft hinein.
»Der Teufel hole die Störenfriede!« rief plötzlich der Mann aus, während er über seine Mätresse hinweg aus dem Bett sprang.
Angélique, die das Klopfen an der Zimmertür nicht gehört hatte, glaubte sich entdeckt und verbarg sich mehr tot als lebendig in der Nische des Türmchens.
Als sie aufblickte, sah sie, daß der Gott sich in einen weiten, braunen, mit einer silbernen Kordel verschnürten Schlafrock gehüllt hatte. Sein Gesicht war das eines jungen Mannes von etwa dreißig Jahren und weniger schön als sein Körper, denn er hatte eine lange Nase und harte Augen, die ihm ein raubvogelartiges Aussehen gaben.
»Ich bin in Gesellschaft der Herzogin von Beaufort«, rief er, zur Tür gewandt.
Trotz dieser Mitteilung erschien ein Diener auf der Schwelle.
»Eure Hoheit wollen mir verzeihen. Ein Mönch hat soeben im Schloß vorgesprochen und besteht darauf, von Monsieur de Condé empfangen zu werden. Der Marquis du Plessis hat es für richtig befunden, ihn sofort zu Eurer Hoheit zu schicken.«

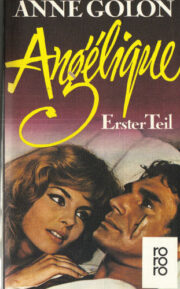
"Angélique" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique" друзьям в соцсетях.