Zwei schwere Lastpferde vervollständigten die Karawane. Das eine trug den alten Wilhelm, der mit der Eskortierung seiner jungen Herren beauftragt war. Allzu viele Gerüchte über Unruhen und Kriege gingen im Lande um. Es hieß, La Rochefoucauld wiegle das Poitou zugunsten des Fürsten Condé auf. Er werbe Soldaten und beschlagnahme einen Teil der Ernten, um die Angeworbenen zu ernähren. Wer Soldaten sagt, sagt Plünderer, sagt Hungersnot und Armut, sagt Räuber und Vagabunden an Straßenkreuzungen.
Der alte Wilhelm also war da, die Lanze auf den Steigbügel gestützt, den alten Degen an der Seite.
Doch die Reise verlief ruhig.
Die Nacht wurde in einer Herberge verbracht, an einer finsteren Wegkreuzung, wo man nur das Pfeifen des Windes in den entblätterten Bäumen hörte.
Der Herbergsvater geruhte, ihnen ein klares, Fleischbrühe genanntes Wasser vorzusetzen sowie einige Käse, die sie beim Schein einer kümmerlichen Unschlittkerze verzehrten.
Von Zeit zu Zeit hallte der Galopp eines Pferdes auf der vom Frost gehärteten Straße. Aber selten hielt ein Wagen an. Die vornehmen Reisenden suchten lieber die Schlösser guter Freunde auf, als die Nacht in einer einsamen Herberge zu verbringen, wo man Gefahr lief, zumindest ausgeplündert zu werden. In der Wirtsstube saßen nur zwei oder drei Hausierer, ein jüdischer Kaufmann und vier Postkuriere. Sie rauchten lange Pfeifen und tranken einen fast schwarzen Wein. Madelon wurde es immer beklommener ums Herz.
Als es Zeit zum Schlafengehen wurde, fand man nur ein einziges Bett vor, das jedoch so groß war, daß alle fünf darin Platz fanden; die drei Mädchen am Kopfende, die beiden Jungen am unteren. Der alte Wilhelm legte sich an die Tür, der Diener zu den Pferden im Stall.
Sie hatten noch eine Tagereise vor sich. Da sie auf den ausgefahrenen und hartgefrorenen Wegen wie ein Sack voller Nüsse durchgeschüttelt wurden, fühlten sich die drei Schwestern völlig zerschlagen. Nur ganz selten begegnete man den Resten der römischen Heerstraße mit ihren großen, regelmäßigen Steinplatten. Vor den Brücken mußte man zuweilen stundenlang in der eisigen Kälte warten, da die Zollbeamten meistens träge und geschwätzige Leute waren, für die jeder Passant willkommene Gelegenheit zu einem kleinen Plausch darstellte.
Angélique konnte nicht umhin, einen Seufzer der Erleichterung auszustoßen, als am Abend des zweiten Tages Poitiers mit seinen blaßrosa gedeckten, einen Hügel emporklimmenden Häusern auftauchte. Es war ein klarer Wintertag, und man konnte sich in die südlichen Provinzen versetzt glauben, deren Schwelle das Poitou darstellt, so zart war der Himmel über den Ziegeldächern. Die Glocken läuteten, einander antwortend, das Angelus.
Diese Glocken sollten von nun an fast fünf Jahre lang Angéliques Tagesablauf bestimmen. Poitiers war eine Stadt der Kirchen, der Klöster, der Kollegien. Die Glocken regelten das Leben dieser ganzen Schar von Soutanen, dieser Armee von Studenten, die im selben Maße lärmten, wie ihre Lehrer flüsterten. Priester und Gymnasiasten begegneten einander an den Kreuzungen der ansteigenden Straßen, im Dämmerlicht der Höfe, auf den Plätzen, die sich in terrassenförmiger Anordnung den zur Stadt Pilgernden darboten.
Die Sancé-Kinder trennten sich auf dem Domplatz. Das Kloster der Ursulinerinnen lag etwas links ab und beherrschte den Fluß Clain. Die Schule der Jesuitenpatres befand sich ganz oben auf der Höhe. In ihrer jugendlichen Unbeholfenheit wußten sie einander nichts zu sagen, und nur die in Tränen aufgelöste Madelon küßte ihre beiden Brüder.
So schloß sich die Klosterpforte hinter Angélique. Sie brauchte lange, bis sie begriff, daß das Gefühl des Erstickens, das sie bedrängte, von der plötzlichen Umweltveränderung herrührte. Mauern und immer wieder Mauern und dazu Gitter an den Fenstern. Ihre Gefährtinnen wirkten nicht sympathisch auf sie: Immer hatte sie mit Knaben gespielt, kleinen Bauernjungen, die sie bewunderten und ihr gehorchten. Hier, zwischen jungen Damen von hoher Abkunft und gesichertem Vermögen, konnte Angéliques Platz nur in den letzten Reihen sein.
Sie mußte sich auch der Tortur des Fischbein-schnürleibs unterziehen, der jedes Mädchen zu einer aufrechten Haltung zwang und es für sein ganzes Leben an das Gehabe einer stolzen Königin gewöhnte. Die kräftige und muskulöse, dabei empfindsame Angélique hätte auf diese Zwangsjacke gern verzichtet. Aber es handelte sich da um eine Vorschrift, die sich keineswegs nur auf das Kloster beschränkte. Nach den Äußerungen der Älteren konnte es keinen Zweifel geben, daß der Schnürleib bei allem, was die Mode betraf, eine große Rolle spielte. Natürlich wurden solche Gespräche im geheimen geführt, obwohl es ausdrücklich zu den Pflichten des Klosters gehörte, die jungen Mädchen auf die Ehe und das gesellschaftliche Leben vorzubereiten.
Man mußte tanzen, grüßen, Laute und Klavichord spielen lernen, man mußte lernen, mit zwei oder drei Mitschülerinnen ein Gespräch über ein gegebenes Thema zu führen, ja man bekam sogar beigebracht, wie man fächelte und wie man sich schminkte. Großer Wert wurde auch auf die hauswirtschaftliche Ausbildung gelegt. Um für etwa eintretende widrige Umstände gewappnet zu sein, mußten sich die Zöglinge den niedrigsten Verrichtungen unterziehen. Sie arbeiteten abwechselnd in den Küchen oder in den Waschhäusern, entzündeten und unterhielten die Lampen, fegten und wischten die Fliesen auf. Schließlich wurden ihnen einige wissenschaftliche Anfangsgründe eingetrichtert: reichlich trocken dargestellte Geschichte und Geographie, Mythologie, ein bißchen Mathematik, Religionslehre. Mehr Zeit wurde auf die Ausbildung des Stils verwandt, da die Kunst des Briefeschreibens eine im wesentlichen weibliche war und die Korrespondenz mit Freunden und Liebhabern eine der absorbierendsten Tätigkeiten einer Frau von Welt darstellte.
Ohne eine ungelehrige Schülerin zu sein, gab Angélique ihren Lehrern wenig Anlaß zur Zufriedenheit. Sie führte aus, was man von ihr verlangte, schien aber nicht zu begreifen, warum man sie zu so vielen stumpfsinnigen Dingen zwang. Bisweilen suchte man sie zur Zeit der Unterrichtsstunden vergeblich, um sie schließlich auf dem Gemüseland zu entdecken, das nichts als ein großer, über muffigen und wenig begangenen Gäßchen hängender Garten war. Auf die strengsten Vorhaltungen pflegte sie zu antworten, sie sei sich nicht bewußt, etwas Böses zu tun, wenn sie dem Wachsen des Kohls zuschaue.
Im darauffolgenden Sommer breitete sich in der Stadt eine recht schlimme Epidemie aus, die als Pest bezeichnet wurde, weil viele Ratten aus ihren Schlupflöchern hervorkamen und in den Straßen und Häusern verendeten.
Die von Condé und Turenne geleitete Fronde der Fürsten brachte Elend und Hungersnot in die westlichen Provinzen, die bisher von den auswärtigen Kriegen verschont geblieben waren. Man wußte nicht mehr, wer für den König war und wer gegen ihn, aber die Bauern der verwüsteten Dörfer strömten nach den Städten und bildeten bald eine ganze Armee von Verarmten, die sich mit ausgestreckter Hand an den Torwegen drängten. Bald gab es deren mehr als Geistliche und Schüler.
Die kleinen Pensionärinnen der Ursulinerinnen teilten an gewissen Tagen zu gewissen Stunden Almosen an die Armen aus, die vor dem Kloster warteten.
Man belehrte sie, daß auch dies zu ihren zukünftigen Pflichten als vollendete große Damen gehören würde.
Zum erstenmal sah Angélique das hoffnungslose Elend vor sich, das Elend in Lumpen, das wirkliche Elend mit dem schamlosen, haßerfüllten Blick. Es rührte sie nicht, es brachte sie nicht außer Fassung, im Gegensatz zu ihren Mitschülerinnen, von denen manche weinten oder angeekelt die Lippen zusammenpreßten. Aber es war ihr, als erkenne sie ein Bild wieder, das sie von jeher in ihrem Innern bewahrte, eine Vorahnung dessen, was ihr ein seltsames Schicksal bescheiden sollte.
Die Pest hatte in den schmutzigen, steilen Gassen, in denen der sengende Juli die Brunnen zum Versiegen brachte, leichtes Spiel. Auch unter den Zöglingen gab es mehrere Fälle. Eines Morgens konnte Angélique in der Pause Madelon nicht auf dem Schulhof finden. Sie erkundigte sich, und man sagte ihr, das erkrankte Mädchen sei ins Spital gebracht worden.
Es gelang ihr, sich bis ans Bett ihrer Schwester zu schleichen. Die Kleine atmete mühsam; ihre Haut fühlte sich glühend an. Der Zustand verschlimmerte sich. Am dritten Tage wurde die ältere Schwester von Angst erfaßt. »Vielleicht stirbt sie?« Dergleichen erschien ihr unmöglich. Viele Menschen um sie herum mochten sterben, aber nichts würde je der unberühr-baren Festung etwas anhaben können, die von den Kindern de Sancé aus dem alten Schlosse Monteloup gebildet wurde. Madelon würde nicht sterben.
Angélique hob den Lockenkopf ihrer Schwester und benetzte ihr die Lippen mit der neben dem Bett stehenden Flüssigkeit. Die Kleine trank gierig.
»Man läßt sie verdursten«, sagte sich Angélique. »Sie wird schlecht gepflegt! Was ist das überhaupt für ein Tee? Lindenblüten? Er ist nicht stark genug. Ich kenne Kräuter, die schweißtreibend wirken und das Übel aus der Haut ziehen: die Holunderblüte, das Blatt der Klette ... Sie müßte davon trinken, einen guten, ganz dunklen Tee, den ich selbst bereite .«
»Angélique«, murmelte Madelon, die gerade die Augen aufgeschlagen hatte.
»Liebling?«
»Erzähl mir was.«
Angélique kramte in ihrem Gedächtnis.
»Was denn? Die Geschichte von Gilles de Retz und .«
»Nein, nein! Das macht mir Angst. Immer, wenn ich die Augen zumache, sehe ich an der Wand aufgehängte Kinder.«
»Was sonst?«
Was Angélique auch einfiel, es waren alles grauliche Geschichten von Räubern, Gespenstern oder mutwilligen Kobolden.
»Das macht nichts«, seufzte Madelon, »wenn du nur redest. Du hast eine so hübsche Stimme. Niemand hat eine Stimme wie deine. Ich möchte sie hören.«
Angélique begann über die Kleinsten in Monteloup zu sprechen, über Marie-Agnès, Albert und den Letztgeborenen, Jean-Marie. Madelon lächelte zuerst, dann zogen sich ihre Lippen zusammen, und sie schien in ihre Erstarrung zurückzufallen. Angélique entfernte sich geräuschlos. Es war die Zeit einer Geschichtsstunde, aber das kümmerte sie nicht.
Eine Viertelstunde später war sie im Gemüsegarten des Klosters. Sie holte eine Leiter, lehnte sie von innen an die Mauer und sprang leichtfüßig auf die Gasse. Die Mauer war ziemlich hoch, aber Angélique hatte ihre Geschmeidigkeit nicht verloren.
Nun rannte sie durch die mit runden Steinen gepflasterten Straßen, über denen glühend heiße Luft lastete. Zu Füßen der Hauswände lagen Körper ausgestreckt, die zu schlafen schienen. Gefräßige Fliegenschwärme umgaben sie. Angélique merkte bald, daß es Leichen waren.
Ihr Instinkt trieb sie bergauf in die reine Luft des hochgelegenen Stadtteils. Sie überquerte belebte Plätze, auf denen die Seminaristen, unbekümmert um die Nachbarschaft des Todes, erregt debattierten, und erreichte schließlich das freie Land. Sie mußte noch lange gehen, bis sie an einem Bach die Holunderblüten fand, die sie suchte. Sie füllte ihr Brusttuch aus schwarzem Taft damit und kehrte in der Dämmerung zurück, die endlich ein wenig Abkühlung brachte. Um das Kloster der Ursulinerinnen wiederzufinden, mußte sie mehrmals nach dem Wege fragen. Man be-gegnete in jenen Tagen des Grauens und des Elends so vielen seltsamen Gestalten in Poitiers, daß niemand sich über das junge Mädchen im grauen Zöglingskleid und mit den wehenden Haaren verwunderte.
Angélique läutete an der Klosterpforte, denn wenn es ihr auch gelungen war, von der hohen Mauer herunterzuspringen, vermochte sie doch nicht, sie auf dem umgekehrten Wege zu überklettern. Die Schwester Pförtnerin sagte ihr, man habe sie gesucht, und die Damen seien höchst ungehalten über ihr Benehmen.
Sie begegnete der Oberin in einem der Flure. Es war eine noch junge Frau, die jüngste Tochter einer herzoglichen Familie.
»Mademoiselle de Sancé«, sagte sie, »Eure Eskapade ist unqualifizierbar.«
»Mutter, ich bin Pflanzen suchen gegangen, um meine Schwester zu versorgen.«
»Gott hat Euch bereits gestraft, meine Tochter.«
»Es ist mir völlig gleichgültig, ob Gott mich bestraft oder nicht«, rief Angélique mit vor Hitze und Ermüdung hochrotem Gesicht aus, »aber ich will selbst diesen Kräutertee bereiten.«
»Meine Tochter, es ist zu spät, um etwas zu wollen. Eure Schwester ist tot.«
Im Angesicht des kleinen, bleichen und wie ausgedörrten Leichnams weinte Angélique nicht. Sie verübelte sogar Hortense deren unaufrichtige Tränen. Warum weinte denn diese siebzehnjährige Hopfenstange? Sie hatte weder Madelon noch sonst jemanden geliebt, nur sich selbst.
»Ja, meine Kleinen«, sagte die alte Ordensschwester zu ihnen, »das ist eben Gottes Wille. Viele Kinder sterben. Man hat mir gesagt, Eure Mutter habe zehn Kinder gehabt und nur ein einziges verloren. Mit diesem hier sind es zwei. Das ist nicht viel. Ich kenne eine Dame, die fünfzehn Kinder hatte und sieben davon verlor. Seht Ihr, so ist das. Gott gibt sie, Gott nimmt sie wieder. Viele Kinder sterben. Das ist Gottes Wille! ...«

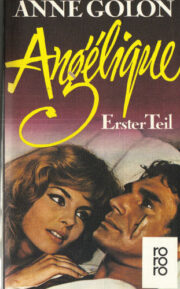
"Angélique" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique" друзьям в соцсетях.