»Ssst!«
Er zog sie an sich wie ein Mann, der mit den Frauen umzugehen weiß, und drückte ihre Wange an die seine, um sie zu beruhigen.
»Ich bin ein ziemlich verworfener Bursche, meine Liebe, aber Euer kleines Herz zu martern, das ist etwas, dessen ich nie fähig wäre. Und außerdem gibt es nach dem König keinen Menschen, dem ich so zugetan bin wie dem Grafen Peyrac. Wir wollen uns keine unnötigen Sorgen machen, Kindchen. Vielleicht ist er rechtzeitig entwischt.«
»Ja, aber ...«, riefAngélique aus.
Er machte eine beschwörende Geste.
»Ja, aber«, wiederholte sie leiser, »warum sollte der König gesonnen sein, ihn zu verhaften? Seine Majestät hat noch gestern abend sehr huldvoll mit ihm gesprochen, und ich selbst habe Worte belauscht, mit denen er der Sympathie Ausdruck gab, die Joffrey ihm eingeflößt hat.«
»Ach, Sympathie! Staatsraison ... Einflüsse ...! Es steht uns armen Höflingen nicht zu, die Beweggründe des Königs zu werten. Denkt daran, daß er Schüler Mazarins war und daß der Kardinal folgendes über ihn sagte: >Er wird sich spät auf den Weg machen, aber er wird es weiter bringen als die andern.<«
»Glaubt Ihr nicht, daß eine Intrige des Erzbischofs von Toulouse dahintersteckt?«
»Ich weiß nichts ... ich weiß gar nichts«, wiederholte Péguillin.
Er begleitete sie bis zu ihrem Haus und versprach, weiter nachzuforschen und sie am Morgen aufzusuchen.
Als Angélique eintrat, hoffte sie verzweifelt, ihr Mann werde dasein und sie erwarten, aber sie fand nur Margot vor, die den schlafenden Florimond hütete, und die alte Tante, die man über dem Festtrubel völlig vergessen hatte. Die übrigen Dienstboten waren zum Tanz in die Stadt gegangen.
Angélique warf sich in ihren Kleidern aufs Bett, nachdem sie lediglich Schuhe und Strümpfe abgelegt hatte. Ihre Füße waren geschwollen von dem irrsinnigen Gang, den sie mit dem Herzog von Lauzun durch die Stadt gemacht hatte. Ihr Hirn lief leer.
»Ich will morgen nachdenken«, sagte sie zu sich.
Und sie fiel in tiefen Schlaf.
Sie wurde durch einen Ruf geweckt, der von der Straße heraufdrang.
»Médême! Médême ...!«
Der Mond wanderte über die flachen Dächer der kleinen Stadt. Vom Hafen und vom Hauptplatz tönten noch Lärm und Gesang herüber, aber in der nächsten Umgebung war alles still. Fast alle Menschen schliefen, zutiefst erschöpft.
Angélique hastete auf den Balkon und erkannte den schwarzen Kouassi-Ba, der drunten im Mondlicht stand.
»Médême! Médême ...!«
»Warte, ich mach’ dir auf.«
Ohne sich die Zeit zu nehmen, ihre Schuhe anzuziehen, lief sie hinunter, zündete im Flur eine Kerze an und schloß die Haustür auf.
Der Schwarze glitt mit einem geschmeidigen Raubtiersprung ins Innere. Seine Augen funkelten seltsam; sie sah, daß er bebte, als befände er sich in einem Trancezustand.
»Woher kommst du?«
»Von dort drüben«, sagte er mit einer unbestimmten Armbewegung. »Ich brauche ein Pferd. Sofort ein Pferd!«
Seine Zähne entblößten sich in einer wilden Grimasse.
»Mein Herr ist angegriffen worden«, flüsterte er, »und ich hatte meinen großen Säbel nicht bei mir. Oh, warum hatte ich ausgerechnet heute meinen großen Säbel nicht bei mir?«
»Angegriffen, Kouassi-Ba? Von wem?«
»Ich weiß nicht, Herrin. Wie soll ich es wissen, ich, ein armer Sklave? Ein Page brachte ihm ein Briefchen. Der Herr ist hingegangen. Ich bin ihm gefolgt. Es waren keine Leute im Hofjenes Hauses; nur eine Kutsche mit dunklen Vorhängen. Männer kamen heraus und umzingelten ihn. Der Herr zog seinen Degen. Weitere Männer kamen dazu und zerrten ihn in die Kutsche. Ich habe geschrien und mich an die Kutsche geklammert. Zwei Diener waren hinten aufgestiegen. Sie schlugen auf mich ein, bis ich zu Boden stürzte. Aber ich habe einen von ihnen mitgerissen und erdrosselt.«
»Du hast ihn erdrosselt?«
»Mit meinen Händen. So«, sagte der Schwarze, wobei er seine rosigen Handflächen wie eine Zange öffnete und schloß. »Die Sonne brannte zu sehr, und meine Zunge ist dicker als mein Kopf, so durstig bin ich.«
»Trink erst etwas, nachher wirst du reden.«
Sie folgte ihm in den Stall, wo er einen Eimer ergriff und lange trank.
»Jetzt«, sagte er, indem er sich die wulstigen Lippen wischte, »werde ich ein Pferd nehmen und ihnen nachsetzen. Ich werde sie alle mit meinem großen Säbel umbringen.«
Er schob das Stroh beiseite und holte seine wenigen Habseligkeiten hervor. Während er sein zerrissenes und beschmutztes Seidengewand auszog, um es mit einer einfacheren Dienerlivree zu vertauschen, machte Angélique das Pferd des Negers los. Die Strohhalme stachen in ihre nackten Füße, aber sie achtete nicht darauf. Es war ihr, als sei sie in einem quälenden Traum befangen, in dem alles zu langsam ging, viel zu langsam ... Sie lief ihrem Gatten entgegen, sie breitete die Arme nach ihm aus, aber nie mehr würde sie ihn umfangen können, nie mehr ...
Sie beobachtete, wie der schwarze Reiter davonstob. Die Hufe des Pferdes schlugen Funken auf den Pflastersteinen der Straße. Das Geräusch des Galopps verklang, während ein anderes Geräusch dem klaren Morgen entsproß: das der Glocken, die einen Dankgottesdienst einläuteten.
Die königliche Hochzeitsnacht ging zu Ende. Die Infantin Maria-Theresia war Königin von Frankreich.
Durch das blühende Land reiste der Hof nach Paris zurück.

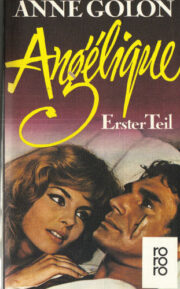
"Angélique" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique" друзьям в соцсетях.