»Um Gottes willen, Hoheit, was habt Ihr in Erfahrung gebracht?«
»Wartet, bis wir bei mir sind und keine Lauscher zu befürchten haben.«
Als sie auf einem bequemen Ruhebett nebeneinander Platz genommen hatten, fuhr Mademoiselle fort:
»Offen gesagt, ich habe sehr wenig erfahren, und wenn man bedenkt, wieviel sonst bei jeder Gelegenheit am Hofe geklatscht wird, muß ich gestehen, daß eben dieses Schweigen mich beunruhigt. Die Leute wissen nichts oder tun so, als ob sie nichts wüßten.« Sie fügte zögernd und mit gedämpfter Stimme hinzu: »Euer Gatte ist der Hexerei angeklagt.«
Um die gute Prinzessin nicht zu verstimmen, unterdrückte Angélique die Bemerkung, daß sie es bereits wisse.
»Das ist nicht schlimm«, fuhr Mademoiselle de Montpensier fort, »und die Sache hätte sich mühelos erledigt, wäre Euer Gatte einem Kirchengericht übergeben worden, wie es der Gegenstand der Anklage eigentlich vorschreibt. Ich will Euch nicht verheimlichen, daß ich die Leute von der Kirche zuweilen einigermaßen empfindlich und rücksichtslos finde, aber man muß anerkennen, daß ihre Rechtsprechung, wenn sie sich mit Dingen befaßt, die innerhalb ihres Kompetenzbereichs liegen, meistens gerecht und klug ist. Aber das Entscheidende ist die Tatsache, daß man Euern Gatten trotz dieser speziellen Anschuldigung der weltlichen Gerichtsbarkeit unterstellt hat. Und da mache ich mir keine Illusionen. Wenn es zu einem Verfahren kommt, was keineswegs sicher ist, wird der Ausgang einzig von der Persönlichkeit der Geschworenen abhängen.«
»Wollt Ihr damit sagen, Hoheit, daß die weltlichen Richter voreingenommen sein könnten?«
»Das hängt davon ab, wen man dazu bestimmt.«
»Und wer bestimmt sie?«
»Der König.«
Angesichts der verängstigten Miene der jungen Frau erhob sich die Prinzessin, legte die Hand auf Angéliques Schulter und bemühte sich, sie aufzuheitern. Alles würde gut enden, dessen war sie gewiß. Aber man mußte auf den Grund der Sache vorstoßen. Ohne Anlaß sperrte man einen Mann von der Stellung und dem Range eines Monsieur de Peyrac nicht unter solchen Geheimhaltungsmaßregelnein. Sie war bei ihren Nachforschungen bis zum Erzbischof von Paris vorgedrungen, dem Kardinal de Gondi, einem ehemaligen Anhänger der Fronde, der mit Monseigneur de Fontenac auf gespanntem Fuß stand.
Durch diesen Kardinal, von dem kaum anzunehmen war, daß er die Handlungen seines mächtigen toulousanischen Rivalen billigte, hatte sie erfahren, daß zwar der Erzbischof von Toulouse tatsächlich die erste Anklage wegen Hexerei veranlaßt zu haben schien, dann aber auf undurchsichtige Weise gezwungen worden war, zugunsten der königlichen Gerichtsbarkeit auf seinen Angeklagten zu verzichten.
»Die Eminenz von Toulouse hatte in Wirklichkeit nicht die Absicht, die Dinge so weit zu treiben, und da sie zumindest im Fall Eures Gatten nicht an Hexerei glaubte, hätte sie sich damit begnügt, ihm entweder vor dem Kirchentribunal oder vor dem Parlament von Toulouse einen Verweis zu erteilen. Aber man hat ihr den Angeklagten durch einen speziellen und von langer Hand vorbereiteten Verhaftbefehl aus den Händen gerissen.«
Mademoiselle erklärte dann, sie sei, während sie ihre Nachforschungen auf ihre hohe Verwandtschaft ausgedehnt habe, immer mehr zur Überzeugung gekommen, daß man Joffrey de Peyrac der geplanten Aktion des Parlamentstribunals von Toulouse gewaltsam entzogen habe.
»Ich weiß es aus dem Munde von Monsieur Masse-neau selbst, einem ehrenwerten Parlamentarier des Languedoc, der soeben aus mysteriösen Gründen nach Paris beordert wurde und vermutet, daß es sich dabei um die Angelegenheit Eures Gatten handelt.«
»Masseneau?« sagte Angélique nachdenklich.
Plötzlich sah sie den bändergeschmückten kleinen Mann mit dem roten Gesicht vor sich, der auf der staubigen Landstraße von Salsigne dem unverschämten Grafen Peyrac mit dem Stock gedroht und ihm nachgerufen hatte: »Ich werde dem Statthalter des Languedoc schreiben ... dem Ministerrat des Königs ...!«
»O mein Gott«, murmelte sie, »das ist ein Feind meines Gatten.«
»Ich habe persönlich mit diesem Beamten gesprochen«, sagte die Herzogin von Montpensier, »und obwohl er bürgerlicher Herkunft ist, hat er einen recht ehrlichen und würdigen Eindruck auf mich gemacht. Tatsächlich fürchtet er sehr, in der Angelegenheit des Grafen Peyrac zum Geschworenen bestimmt zu werden, zumal bekannt ist, daß er eine Auseinandersetzung mit ihm hatte. Er sagte, daß Beleidigungen, die man in der Mittagshitze einander an den Kopf werfe, keinen Einfluß auf den Lauf der Gerechtigkeit hätten und daß es ihm sehr peinlich wäre, sich zu einem Scheinprozeß hergeben zu müssen.«
Angélique hatte sich nur ein einziges Wort eingeprägt: Prozeß!
»Man denkt also daran, einen Prozeß zu eröffnen? Ein Advokat, von dem ich mich beraten ließ, sagte mir, es sei schon viel gewonnen, wenn man das erreichte, vor allem, wenn er sich vor einem Tribunal des Parlaments von Paris abspielte. Die Anwesenheit dieses Masseneau, der selbst Parlamentsmitglied ist, beweist ja eigentlich, daß es dazu kommen wird.«
Mademoiselle de Montpensier verzog ihr Gesicht zu einer Grimasse, die sie nicht eben verschönte.
»Ihr wißt ja, meine Liebe, daß ich mich in den Kniffen und Rechtsverdrehungen der Leute vom Gericht ganz gut auskenne. Nun, Ihr könnt mir glauben, daß ein aus Parlamentariern zusammengesetztes Tribunal Eurem Gatten nichts nutzen würde, weil fast alle Parlamentarier Fouquet, dem derzeitigen Oberintendanten der Finanzen, verpflichtet sind und sich nach seinen Anweisungen richten würden, um so mehr, als dieser ein ehemaliger Präsident des Parlaments von Paris ist.«
Angélique erschrak zutiefst. Fouquet! Da zeigte also das unheimliche Eichhörnchen wieder einmal seine scharfen Zähne.
»Weshalb sprecht Ihr mir von Monsieur Fouquet?« fragte Angélique mit unsicherer Stimme. »Ich schwöre Euch, daß mein Gatte nichts getan hat, was ihm dessen Zorn zugezogen haben könnte. Im übrigen hat er ihn nie gesehen!« Mademoiselle zuckte die Schultern. »Ich persönlich habe keine Spione in Fouquets Umgebung. Dergleichen ist nicht meine Sache, wenn ich es auch diesmal im Interesse Eures Gatten bedaure. Aber durch den Bruder des Königs, der, wie ich vermute, ebenfalls in Fouquets Sold steht, habe ich erfahren, daß Ihr beide, Ihr und Euer Gatte, ein Fouquet betreffendes Geheimnis bewahrt.«
Angélique blieb das Herz stehen. Sollte sie sich ihrer großen Beschützerin rückhaltlos anvertrauen? Sie war nahe daran, es zu tun, erinnerte sich aber noch rechtzeitig, wie unbedacht diese war und wie unfähig dazu, den Mund zu halten.
Die junge Frau seufzte und sagte mit abgewandtem Blick:
»Was kann ich über diesen mächtigen Herrn wissen, dem ich nie begegnet bin? Freilich erinnere ich mich, daß man, als ich noch klein war, von einer angeblichen Verschwörung der Edelleute sprach, in die Fouquet, der Fürst Condé und andere große Namen verwickelt waren. Bald darauf kam es zur Fronde.«
Es war recht gewagt, der Grande Mademoiselle gegenüber solche Äußerungen zu machen, aber diese nahm keinen Anstoß an ihnen und versicherte, ihr Vater habe sein Leben auch mit dem Anstiften von Verschwörungen verbracht.
»Das war sein Hauptlaster. Im übrigen war er zu gut und zu weich, um die Zügel des Königreichs in die Hand zu nehmen. Jedenfalls hat er nicht konspiriert, um sich zu bereichern.«
»Wohingegen mein Gatte reich geworden ist, ohne zu konspirieren«, sagte Angélique mit einem matten Lächeln. »Vielleicht ist es das, was ihn verdächtig macht.«
Mademoiselle stimmte zu und gab außerdem zu bedenken, daß die mangelnde Fähigkeit des Schmeichelns bei Hofe als ein schwerwiegender Fehler gewertet werde. Aber das allein rechtfertige noch nicht einen vom König unterschriebenen geheimen Verhaftbefehl.
»Da muß noch etwas anderes im Spiel sein«, versicherte die Grande Mademoiselle und wiederholte damit unbewußt den Ausspruch des Advokaten Desgray. »Jedenfalls kann einzig und allein der König einschreiten. Oh, er ist nicht leicht zu beeinflussen! Mazarin hat ihn auf die florentinische Diplomatie dressiert. Man kann ihn lächeln und sogar mit einer Träne im Auge sehen, denn er ist zartfühlend . während er gleichzeitig den Dolch zückt, um einen Freund ins Jenseits zu befördern.«
Da sie sah, daß Angélique erblaßte, legte sie den Arm um ihre Schulter und sagte in jovialem Ton:
»Ich rede dummes Zeug, wie immer. Man darf mich nicht ernst nehmen. Niemand nimmt mich mehr ernst in diesem Königreich. Deshalb komme ich zum Ende: Wollt Ihr den König sprechen?«
Und als Angélique sich unter der Einwirkung der unaufhörlichen kalten Duschen der Grande Mademoiselle zu Füßen warf, brachen beide in Tränen aus. Worauf Mademoiselle de Montpensier ihr mitteilte, die hochnotpeinliche Audienz sei bereits anberaumt und der König werde Madame de Peyrac in zwei Stunden empfangen.
Weit davon entfernt, außer Fassung zu geraten, fühlte sich Angélique von einer merkwürdigen Ruhe durchdrungen. Dieser Tag würde, das wußte sie nun, von entscheidender Bedeutung für sie sein.
Da ihr keine Zeit blieb, nach Saint-Landry zurückzukehren, bat sie Mademoiselle um die Erlaubnis, sich deren Puder und Schminke bedienen zu dürfen, um einigermaßen präsentabel zu sein. Mademoiselle lieh ihr bereitwillig eine ihrer Kammerfrauen dazu.
Vor dem Spiegel des Frisiertischs fragte sich Angélique, ob sie wohl noch hübsch genug sei, um den König günstig zu stimmen. Ihre Taille war stärker geworden, ihr einstmals kindlich-rundes Gesicht jedoch wesentlich schmaler. Zarte Ringe umgaben ihre Augen, und ihr Teint war blaß. Nach strenger Prüfung fand sie, daß das länglichere Gesicht und die durch die bläulichen Schatten größer wirkenden Augen ihr gar nicht übel standen. Es verlieh ihr einen pathetischen, rührenden Ausdruck, der nicht ohne Reiz war.
Sie legte ganz wenig Schminke auf, befestigte ein schwarzes Schönheitspflästerchen in der Schläfengegend und überließ sich den geschickten Händen der Friseuse.
Das Kleid sah noch sehr schön aus, nur sein Saum war durch den zähen Pariser Straßenschmutz verdorben. Doch sagte sie sich, daß der König ja schließlich wußte, daß man ihren gesamten Besitz versiegelt hatte, und sich nicht darüber wundern würde, daß sie in Bedrängnis war.
Sie bedauerte, keine Zeit zu haben, sich vorher mit Desgray zu besprechen. Sollte sie sich dem König gegenüber in plumpen, höfischen Schmeicheleien ergehen? Solche Worte würden in ihrem Munde unecht klingen! Sie beschloß, eine vertrauensvolle Haltung einzunehmen, ihrem festen Glauben an den Gerechtigkeitssinn des Monarchen Ausdruck zu geben. Sie würde ihm die Schuldlosigkeit ihres Gatten darlegen, ihm begreiflich machen, daß es einem König wie Ludwig XIV. übel anstünde, wenn er sich weigerte, Milde walten zu lassen.
Angélique betrachtete sich noch immer im Spiegel, und sie sah ihre grünen Augen funkeln wie die einer Katze in der Nacht.
»Das bin nicht mehr ich«, sagte sie zu sich. »Aber es ist gleichwohl eine verführerisch schöne Frau. Oh, der König kann unmöglich unbeeindruckt bleiben. Nur empfinde ich nicht genug Demut vor ihm. O mein Gott, mach, daß ich demütig bin!«
Angélique richtete sich klopfenden Herzens aus ihrem tiefen Knicks auf.

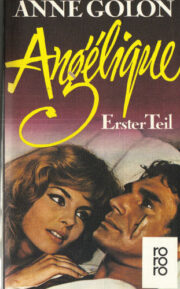
"Angélique" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique" друзьям в соцсетях.