Frances Somerville nickte. «Man kann natürlich die Art und Weise, wie dieser Hitler sich aufführt, nicht billigen – er ist wirklich ein vulgäres Subjekt. Aber die Juden können einem auch nicht gerade sympathisch sein. Wenn sie reich sind, betreiben sie Banken, wenn sie arm sind, gehen sie hausieren, und dazwischen spielen sie Geige. Nach Bowmont kommt mir keiner von diesen Leuten, solange es nach mir geht, das habe ich Quin klipp und klar gesagt.»
Einer der Hunde gähnte mit weitaufgerissenem Maul, sprang vom Sessel und machte es sich zu Frances Somervilles Füßen bequem.
«Sicher, aber wenn es zum Krieg kommen sollte, wird man uns natürlich Evakuierte aus London schicken», sagte Ann Rothley. Sie sprach ganz sachlich, und keiner hätte geahnt, was diese Sachlichkeit sie angesichts der Tatsache, daß ihr vergötterter ältester Sohn Rollo, der gerade achtzehn war, kostete.
«Also, lieber nehme ich hier Slumkinder auf als ausländische Flüchtlinge. Die könnte man ohne weiteres im Bootshaus unterbringen, auf Matratzen, und ihnen das Essen hinübertragen lassen. Aber diese Ausländer – die sind ja völlig distanzlos.»
Es blieb ein Weilchen still, während die beiden Damen von ihrem Kaffee tranken. Ein auffrischender Wind bauschte die Vorhänge.
Dann fragte Ann Rothley: «Hat er eigentlich noch einmal etwas von – du weiß schon – vom Trust gesagt?» Das Zögern der sonst so direkten Ann Rothley zeigte das Maß ihres Unbehagens.
«Ich habe ihn, wie du weißt, seit Monaten nicht gesehen – er war ja in Indien –, aber Turton sagte mir, es habe jemand vom Hauptbüro des Trust angerufen und gesagt, Quin hätte darum gebeten, daß sie später im Jahr einen ihrer Leute hierher schicken. Ich glaube, es ist ihm ernst, Ann.»
«O Gott!» Würde denn der Schändung niemals ein Ende sein? Ganze Güter wurden als Bauland verkauft, ganze Wälder wurden gerodet, das Volk aus der Stadt flanierte gaffend durch die Häuser von Freunden und Bekannten. «Gibt es denn gar keine Hoffnung, daß er sich endlich seiner Pflicht bewußt wird und heiratet?»
Frances zuckte die Achseln. «Ich weiß es nicht, Ann. Livy hat ihn vor seiner Abreise nach Indien im Theater zweimal mit einer jungen Frau gesehen, aber sie hatte nicht den Eindruck, daß es etwas Ernstes war.»
«Bei ihm ist es nie etwas Ernstes», stellte Ann Rothley erbittert fest. «Als heiratete man zum Vergnügen!» Sie schwieg, als sie sich des Horrors ihrer Hochzeitsnacht mit Rothley erinnerte. Aber sie hatte nicht geschrien, und sie war nicht davongelaufen; sie hatte es über sich ergehen lassen, wie sie später seine wöchentlichen Besuche in ihrem Schlafzimmer über sich ergehen ließ: Sie starrte zur Zimmerdecke hinauf und dachte an ihre Stickerei oder ihre Hunde. Dafür waren jetzt Kinder da, und es gab eine Zukunft. Niemand fällte die alten Eichen, der Park wurde regelmäßig gepflegt. Weil Frauen wie sie die Zähne zusammenbissen. «Man heiratet für England», sagte sie. «Für das Land.»
«Ja, ich weiß. Aber was können wir denn noch tun?» sagte Frances müde. «Du weißt, wer alles versucht hat ...»
Sie brauchte den Satz nicht zu Ende zu sprechen. Junge Mädchen aus bester Familie und jeglichen Temperaments waren auf ihren Rassepferden durch die Tore von Bowmont galoppiert, mit ihren Tennisschlägern in der Hand munter über die Rasenplätze gesprungen, hatten in weißem Organdy und raschelndem Tüll Quin beim Tanz verführerisch zugelächelt ...
«Meinst du, er könnte sich für eine Frau interessieren, die etwas von seiner Arbeit versteht?»
«Etwa für eine Studentin?» rief Frances entsetzt.
«Nein – aber, ach, ich weiß nicht. Er geht ja ganz in seiner Arbeit auf, nicht wahr?» Ann Rothley bemühte sich, tolerant zu sein.»Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß ein anständig erzogenes junges Mädchen sich mit vermoderten alten Skeletten auskennt, darum wird wohl in dieser Richtung nichts zu erwarten sein.» Sie stand auf, knotete ihren Schal. «Wie dem auch sei, grüß den Jungen von mir – aber sag ihm, keine Flüchtlinge mehr!»
Nachdem Ann Rothley gegangen war, holte sich Frances Somerville ihre Gartenschere und den flachen Gartenkorb und ging zur Westterrasse hinüber, auf der windgeschützten, dem Meer abgewandten Seite des Hauses. Einen Moment lang blieb sie stehen und blickte auf die Wiesen und Felder hinaus, die sich bis zu den blauen Hügeln des Cheviot-Gebirges dehnten: Hafer und Gerste, saftig grün und hochstehend, auf der langen Wiese eine Herde frisch geschorener Leicester-Schafe. Der neue Verwalter, den Quin eingestellt hatte, machte seine Sache gut.
Dann ging sie über den Rasen, öffnete eine Pforte in der hohen Mauer und trat in eine andere Welt. Die Sonne war hell und warm, um den Lavendel summten die Bienen; der Duft nach Malven und Jasmin kam ihr entgegen – und eine große Stille. Das unaufhörliche Tosen der Brandung klang gedämpft, ein feines Wispern nur.
«Na also», sagte Frances energisch zu dem tibetanischen Mohn, der vor zwei Tagen noch unschlüssig ausgesehen hatte, jetzt aber seine himmelblauen Blütenblätter entfaltete.
Quins Großmutter, die schüchterne und stille Jane Somerville, hatte den Garten angelegt. Die Tochter eines wohlhabenden Kohlebarons hatte die Tröstungen ihres Quäkerglaubens in ihre Zwangsehe mit dem Basher mitgenommen, und sie hatte sie nötig gehabt.
Zwei Jahre hatte Jane schon in Bowmont gelebt, als sie zu ihrem eigenen fassungslosen Entsetzen eines Tages bei der regelmäßigen Versammlung ihrer Glaubensgenossen im Gemeindesaal in Berwick das Wort ergriff.
«Ich werde einen Garten anlegen», verkündete sie.
Danach sprach sie nie wieder bei der Versammlung, aber gleich am nächsten Tag gab sie Anweisung, die Wiese, die sich an den Westrasen anschloß, zu entwässern. Sie reiste auf die andere Seite Englands, um die rosenfarbenen Ziegel eines kürzlich abgerissenen alten Herrenhauses in ihren Besitz zu bringen. Sie pflanzte Hecken an, die den Wind abhalten sollten, baute Mauern und ließ Wagenladungen von Humus anfahren. Die Experten wollten ihr weismachen, sie verschwende ihre Zeit; für einen Garten, wie er ihr vorschwebte, sei das Land viel zu hoch im Norden, dem Meer viel zu nahe. Der Basher, der auf Urlaub von seinem Schiff nach Hause kam, war wütend. Er gebärdete sich wie ein Wilder; stellte jede Rechnung in Frage.
Jane, die sonst so Sanfte und Harmoniebedürftige, ließ sich nicht beirren. Sie überzog die Mauern mit Rosen, Glyzinien und Klematis; sie ließ Pflanzen aus Gegenden kommen, wo es weit kälter, das Klima weit rauher war als in Bowmont: Kamelien und Magnolien aus China, Mohn und Primeln aus dem Atlasgebirge – und mischte sie mit den Blumen, die die Dorfbewohner in ihren Bauerngärten zogen. Sie stellte eine Bank an die Südwand und pflanzte zu beiden Seiten Sommerflieder für die Schmetterlinge. Jahrzehnte später kam der Basher, der immer nur opponiert hatte, zum Sterben hierher.
Frances Somerville kniete an der langen Rabatte nieder und vermerkte das nun schon vertraute Zwicken der Arthritis in ihrem Knie. Das Rotkehlchen flog aus dem Mandelbäumchen herunter, um ihr bei der Arbeit zuzusehen. Aber sehr bald legte sie die Schaufel aus der Hand und ging zu der Bank neben der Sonnenuhr. Sie setzte sich und schloß die Augen.
Was würde aus diesem Garten werden, wenn Quin sein Haus tatsächlich in andere Hände geben sollte? Horden von Menschen würden durch ihn hindurchtrampeln, das Rotkehlchen verscheuchen, kreischend nach den Bienen und Hummeln schlagen. Überall würde es Wegweiser geben – die kleinen Leute schienen unfähig, ohne Schilder zurechtzukommen. Und an der hinteren Wand, wo jetzt die Pfirsiche in der Sonne reiften, würde man zwei Hütten aufstellen. Nein – eine Hütte, in zwei geteilt; sie hatte es in Frampton gesehen. An der einen Tür würde «Damen» stehen, an der anderen «Herren».
«Lieber Gott», betete Frances Somerville laut und richtete das Wort mit ungewohnter Demut an den Herrn, «bitte schicke sie hierher. Sie muß doch irgendwo sein – die Frau, die dieses Haus und diesen Garten retten kann.»
6
Der Regen fiel seit Tagesanbruch; kalt und ohne Unterlaß. Unten auf dem Platz drängten sich die Tauben unter Maria Theresias patinagrünen Röcken. Wien, die besetzte Stadt, hatte dem Frühling den Rücken gekehrt.
Ruth hatte kaum geschlafen. Jetzt faltete sie die Decke auf dem Feldbett, wusch sich, so gut es ging, unter dem Wasserhahn in der kleinen Garderobe und machte sich eine Tasse Kaffee.
Heute ist mein Hochzeitstag, dachte sie; an diesen Tag werde ich denken, wenn ich einmal auf dem Sterbebett liege – und plötzliche Panik packte sie.
Sie hatte ihren Rock und ihren Pullover unter eine Zeitung gelegt und sie mit einem Brett voller Steine beschwert, aber viel Erfolg hatte dieser Versuch, ihre Kleider zu glätten, nicht gehabt. Sollte sie vielleicht doch lieber das Kleid anziehen, das für Heinis Debüt mit den Philharmonikern gedacht gewesen war? Sie hatte es von zu Hause mitgenommen; es hing jetzt hinter der Tür: brauner Samt mit einem braven Kragen aus cremefarbener Spitze. Es stammte aus dem Warenhaus ihres Großvaters. Jetzt waren die Schaufenster des Kaufhauses zertrümmert, und die Leute wurden angehalten, nicht dort zu kaufen. Dem Himmel sei Dank, daß Großvater tot war.
Nein, das war Heinis Kleid – ihr Umblätter-Kleid, denn es spielte sehr wohl eine Rolle, was man anhatte, wenn man die Noten umblätterte. Man mußte hübsch aussehen, aber doch dezent. Das Kleid hatte die Farbe des Bechstein-Flügels im Musikverein – für einen Engländer, der davonlief, wenn er einen Straußwalzer hörte, war es nicht geeignet.
Sie ging langsam durch die Museumsräume, und im grauen Licht der Morgendämmerung traten ihre alten Freunde einer nach dem anderen aus der Dunkelheit. Der Eisbär, der See-Elefant ... der Ichthyosaurus mit der falschen Wirbelsäule. Und das kleine Fingertier, das sie wieder in seine Vitrine gesperrt hatte.
«Wünsch mir Glück», flüsterte sie dem häßlichen kleinen Tier zu und drückte die Stirn an das Glas. Sie schloß die Augen, und die Halbaffen Madagaskars verschwanden, als Bilder der Hochzeitsfeier vor ihr aufstiegen, die sie sich so oft mit ihrer Mutter zusammen ausgemalt hatte. Nicht hier, sondern am Grundlsee hätte sie stattfinden sollen. In einem langen Konvoi von Booten, weil ja alle, die ihr etwas bedeuteten, dabei sein mußten, wäre man zu der kleinen Kirche mit dem Zwiebelturm gerudert. Onkel Mishak hätte ein bißchen gebrummt, weil er sich fein machen mußte; Tante Hildas Reißverschluß hätte geklemmt – und das Zillerquartett hätte gespielt. «Auf dem Steg», hatte sich Ruth gewünscht, aber Biberstein sagte nein, um auf dem Steg zu spielen, sei er zu dick. Sie hätte weißen Organdy getragen und einen Brautstrauß aus Bergblumen, und am Altar hätte Heini mit seinem lockigen Haar und seinem lieben Lächeln auf sie gewartet.
Ach, Heini, verzeih mir. Ich tu es ja für uns.
Wieder in der Garderobe, warf sie noch einmal einen Blick auf ihr Spiegelbild. Nie hatte sie sich so reizlos und durchschnittlich gefunden. Impulsiv löste sie ihr Haar, füllte das Waschbecken mit kaltem Wasser, nahm die grüne Seife, die das Museum seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellte ...
Als Quin kam, war sie fertig, ihr Koffer gepackt.
«Regnet es hier herein?» fragte er überrascht, als er ihr nasses Haar sah.
Sie schüttelte den Kopf. «Ich hab mir die Haare gewaschen, aber die Heizung geht nicht.»
Er sah die Schatten unter ihren Augen, die straffe Haltung ihrer Schultern.
«Kommen Sie. Es wird gleich vorbei sein – und es ist nicht so schlimm wie ein Besuch beim Zahnarzt.»
Am Fuß der Treppe wartete ein Grüppchen Menschen, die ihr Glück wünschen wollten: die Zugehfrau, der Nachtwächter, der alte Präparator. Sie hatten alle gewußt, daß sie hier untergeschlüpft war, und keiner hatte sie verraten. Daran mußte sie sich später immer erinnern, wenn sie an ihren Landsleuten verzweifeln wollte.
Sie hatte sich unter dem britischen Konsulat etwas Beeindrukkendes vorgestellt, aber nach dem Anschluß hatte eine Reihe von Auslandsvertretungen das Quartier wechseln müssen, und so setzte das Taxi sie nur vor einer Reihe Baracken ab, auf deren Blechdächer immer noch der Regen trommelte. Ein mürrischer Handwerker im Ölmantel stocherte mit einem Werkzeug in der überfließenden Regenrinne herum. Das Bild Georgs VI. im provisorischen Büro des Konsuls hing etwas schief; draußen im Flur war jemand beim Staubsaugen.
Der Stellvertreter des Konsuls erwartete sie, allerdings nicht gerade glänzender Laune. Er hatte eine Bindehautentzündung, eine äußerst unangenehme Geschichte, und hielt ein Taschentuch auf sein Auge gedrückt. Zwar fand er Professor Somerville persönlich ganz sympathisch, aber die Art und Weise, wie der Konsul, vermutlich auf Anweisung des Botschafters, diese ganze Angelegenheit durchgeboxt hatte, konnte er nicht billigen. Verfahren, für die man sonst Tage brauchte, wurden plötzlich innerhalb von Stunden erledigt: die Ausstellung der Visa, das Umschreiben der Reisepässe. Garantiert sind da zwei zusammen auf irgendeinem Nobelinternat gewesen, dachte der Vizekonsul, der aus einfachen Verhältnissen stammte. Professor Somervilles Vater vielleicht mit dem Vetter des Botschafters ... Vermutlich hatte eines dieser vor sichtig tastenden Gespräche stattgefunden, bei denen die Engländer der guten Kreise wie Hunde an Laternenpfählen den Stammbaum des anderen zu erschnüffeln suchen, indem sie von der Schule plaudern – Eton oder Harrow? – und dann feststellen, daß sie im Herzen Brüder sind.

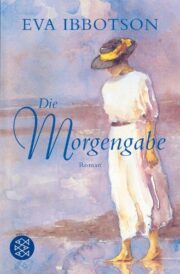
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.