Anfang Dezember beschloß Leonie Channukka zu feiern, das jüdische Fest des Lichts. Licht, fand sie, würde jetzt guttun. Kurt war immer noch in Manchester, und er fehlte ihr; die Nachrichten vom Kontinent wurden immer bedrückender, und das Wetter – feucht und neblig, nicht das klare, frische Winterwetter, das sie aus Wien in Erinnerung hatte – schlug einem aufs Gemüt.
Und dann noch Heini. Heini schlief seit einem Monat auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer und übte jeden Tag acht Stunden auf dem Klavier. Leonie sah natürlich ein, daß das sein mußte, aber während sie mit dem Staubtuch um ihn herumschlich, ertappte sie sich dabei, daß sie sich über die Freunde und Verwandten früherer Klaviervirtuosen Gedanken machte. Gab es vielleicht irgendwo in einer Mansarde in Budapest eine alte Dame, deren Mutter einst schreiend auf die Straße hinausgestürzt war, weil sie sich von Liszts brillanten Arpeggios gefoltert fühlte? War es den Bewohnern des Hauses in der Rue de Rivoli gelungen, sich auf Chopins Übungsstunden einzustellen? Was hatten diese Wiener Zimmerwirtinnen damals wirklich empfunden, wenn Beethoven wieder einmal ein Klavier in Grund und Boden gespielt hatte?
Auch die Essensfrage spielte eine Rolle. Heini hatte aus Ungarn etwas Geld mitgebracht, aber das brauchte er, um seine Hände versichern zu lassen; auch das sah sie ein. Den Rest gab er für die öffentlichen Verkehrsmittel aus, wenn er seine Fahrten zu Agenten und Impresarios machte, von denen er hoffte, daß sie ihm helfen würden.
«Es ist für Ruth», pflegte Heini mit seinem süßen Lächeln zu sagen. «Alles, was ich tue, tue ich für Ruth.»
Und alle akzeptierten das. Heini hatte seine Absicht kundgetan, Ruth zu heiraten und ihr ein angenehmes Leben zu bereiten, sobald er sich etabliert hatte; man konnte also unmöglich an ihm herumkritisieren. Wenn er eine Stunde im Badezimmer verbrachte, so deshalb, weil er bei den geschäftlichen Besprechungen einen guten Eindruck machen mußte; wenn er seine Sachen herumwarf und Leonie hinter sich aufräumen ließ, so deshalb, weil er mit seiner Musik so beschäftigt war, daß für anderes keine Zeit blieb. Ohne Klage also paßten sich die Bewohner von Nummer 27 den neuen Umständen seiner Anwesenheit an.
Mishak war nicht musikalisch. Er liebte die Stille, die sanften Geräusche: den Gesang einer Drossel vor dem Fenster; das Rauschen des Regens; das Sirren einer Sense, wenn der Rasen gemäht wurde. Wenn Heini jetzt auf sein Klavier einhieb, war er von alledem abgeschnitten. Er machte es sich zur Gewohnheit, noch früher aufzustehen, und arbeitete im Garten, bis Heini aufstand, dann ging er auf lange Streifzüge. Aber die Tage wurden kürzer, Mishak war vierundsechzig, immer häufiger trieb es auch ihn, obwohl von Natur aus kein geselliger Mensch, ins Willow.
Paul Ziller hatte bei Heinis Ankunft gehofft, sie würden Duette spielen, denn für Geige und Klavier gibt es sehr vielfältige und sehr schöne Kompositionen. Doch Heini wollte sich verständlicherweise auf eine Solokarriere konzentrieren, und da die Schallisolierung des Hauses nicht solide genug war, um zwei übende Musiker zu verkraften, marschierte Ziller von nun an wieder täglich mit seiner Guarneri ins Jewish Day Center.
Auch Hilda änderte ihren Tageslauf. Der Kustos der anthropologischen Abteilung hatte ihr mittlerweile sogar einen Schlüssel anvertraut. Sie nahm sich Brote mit ins Museum und richtete es so ein, daß sie immer erst nach Hause kam, wenn Fräulein Lutzenholler auf ihren Schlafzimmerstuhl kletterte.
Daß sie der finsteren Psychoanalytikerin noch einmal dankbar sein würden, hätte keiner von ihnen ahnen können, aber so war es. Jeden Abend nämlich, punkt einundzwanzig Uhr dreißig, pflegte sie mit einem langen Besen bewaffnet auf einen Stuhl zu klettern und an die Decke ihres Schlafzimmers zu klopfen, über dem sich das Wohnzimmer der Bergers befand, um wissen zu lassen, daß sie nun zu Bett gehen würde und die Musik aufhören mußte.
Aber das bedeutete, daß Leonie sich nicht über den Zustand des Herds beklagen konnte; ein Fest des Lichts war also alles in allem dringend vonnöten, und da sie selbst nicht genau wußte, was der Brauch vorschrieb, trug sie ihr Problem ins Willow.
«Darf ich Sie zu einem Stück Kuchen einladen?» fragte Mrs. Weiss. Leonie nahm an und fragte die alte Dame um Rat.
«Auf jeden Fall braucht man Kerzen», erklärte Mrs. Weiss entschieden. «Das weiß ich. Man zündet acht Tage lang jeden Tag eine an, und man steckt sie in eine Menora.»
«Wie soll das gehen?» fragte Dr. Levy. «Wenn es acht Tage sind, müssen es acht Kerzen sein, und eine Menora hat nur sieben Arme. Gebete gehören übrigens auch dazu. Meine Großmutter hat immer gebetet.»
«Aber was hat sie gebetet?» fragte Leonie.
Dr. Levy zuckte die Achseln, und Ziller sagte, von Hofmann würde es sicher wissen. «Er wird gleich hier sein.»
«Wieso sollte gerade er es wissen? Er ist doch überhaupt kein Jude», sagte Mrs. Weiss wegwerfend.
«Aber er hat doch in diesem Stück von Isaac Bashevis Singer mitgespielt, wissen Sie nicht mehr? Der Nebbich. Das ist ein sehr jüdisches Stück», sagte Ziller.
Von Hofmann jedoch konnte keine klare Auskunft geben. «In dem Akt war ich nicht dabei», sagte er, «aber es ist eine wunderschöne Feier. Alle Schauspieler waren sehr bewegt, und Steffi hat hinterher auf dem Flohmarkt eine Menora gekauft. Ich könnte sie ja mal fragen – sie verkauft bei Harrod's Strümpfe.»
Aber niemand wollte Steffi bemühen, die zwar eine hervorragende Schauspielerin, aber eine äußerst langweilige Frau war, und Miss Violet und Miss Maud, die diese Diskussion mitangehört hatten, sagten jetzt, sie müßten langsam daran denken, die Weihnachtsdekorationen aus dem Keller zu holen.
Leonie, die sich hier auf vertrautem Boden fühlte, wurde munter. «Wie feiern Sie Weihnachten?» fragte sie die Damen.
«Also, wir gehen zur Abendmesse», antwortete Miss Maud. «Und wir schmücken das Tea-Room und legen auf jeden Tisch einen Stechpalmenzweig.»
«Und die Adventskränze?» fragte Leonie.
«Die gibt es bei uns nicht», antwortete Miss Maud entschieden, der das bedenklich pfäffisch roch.
«Aber einen kleinen Baum mit roten Äpfeln und einem silbernen Stern werden Sie doch haben?»
Die Damen schüttelten die Köpfe und sagten, sie hielten nichts von solchem Aufwand.
«Aber das ist doch kein Aufwand», protestierte Leonie. «Das ist einfach schön.» Und schüchtern fügte sie hinzu: «Ich könnte ja Lebkuchen backen ... mit Zuckerguß und roten Bändern.»
«Georg hat eine große Fichte in seinem Garten», bemerkte Mrs. Weiss. «Ich kann in der Nacht, wenn Moira schläft, ein paar Zweige davon abschneiden.»
«Meine Frau hat ihr kleines Glockenspiel mitgenommen», sagte der Bankier unerwartet. «Ich hielt das für blödsinnig, aber sie hat es schon seit ihrer Kindheit.»
Wieder in der Küche, sahen Miss Maud und Miss Violet einander an.
«Na ja, so schlimm wäre es wahrscheinlich gar nicht», sagte Miss Maud, «aber ich möchte nicht den ganzen Boden voller Tannennadeln haben.»
«Auf jeden Fall ist es besser als dieses Channukka. Ich meine, da werden sie nicht weit kommen, wenn sie sich nicht mal erinnern können, wie es gefeiert wird», meinte Miss Violet.
Mrs. Burtt wand ihren Spüllappen aus und hängte ihn am Spülbecken auf, über dem Ruth mit Reißzwecken ein Diagramm befestigt hatte, das den «Lebenszyklus des Pololo-Wurms» zeigte.
«Und es wird Ruth bestimmt aufmuntern, wenn hier alles so hübsch aussieht», bemerkte sie.
Miss Maud runzelte die Stirn. Sie konnte nicht ganz verstehen, wieso ihre Kellnerin Aufmunterung brauchen sollte. «Sie ist doch sehr glücklich, seit Heini da ist.»
«Ja, aber müde», entgegnete Mrs. Burtt.
Drei Tage nachdem Leonie ihre Idee mit dem Lichtfest wieder ad acta gelegt hatte, ging Ruth auf dem Weg zur Universität auf der Post vorbei und entnahm ihrem Schließfach ein Päckchen mit rotem Siegel, das sie mit klopfendem Herzen öffnete. Minuten später stand sie mitten im Getümmel eilender Menschen und blickte wie gebannt auf den dunkelblauen Reisepaß mit dem goldenen Löwen, dem sich aufbäumenden Einhorn und dem Motto Dieu et Mon Droit in ihrer Hand.
«Ich bin britische Staatsbürgerin», sagte sie laut und sah im Geist, wie der Außenminister in Cut und Zylinder ihr einen Schlagbaum nach dem anderen öffnete.
Wenn sie es doch nur allen hätte zeigen können: die Einbürgerungsurkunde, die ihren neuen Status bestätigte; den Reisepaß, der auf sie allein ausgestellt war. Ach, hätte sie doch jetzt, den Reisepaß schwenkend, ins Willow marschieren können, um ihre Eltern zu umarmen und mit Mrs. Burtt einen Freudentanz aufzuführen.
Aber sie konnte die Papiere natürlich niemandem zeigen. Sie waren auf Ruth Somerville ausgestellt, nicht auf Ruth Berger, und darum würden Reisepaß und Einbürgerungsurkunde dort verschwinden müssen, wo schon die anderen Papiere lagen, in dem geheimen Versteck, in dem sich die nicht totzukriegenden Mäuse tummelten.
Sie war sehr früh auf dem Weg zur Universität. Seit Heini da war, stellte Ruth den Wecker unter ihrem Kopfkissen immer auf halb sechs, damit sie zwei Stunden arbeiten konnte, solange es noch ruhig war. Als sie jetzt in der Untergrundbahn saß, überkam sie der Wunsch, diesen Tag irgendwie zu feiern, und impulsiv stieg sie an der nächsten Haltestelle aus und eilte die Stufen zur National Gallery hinauf, um auf den Trafalgar Square hinunterzublicken.
Sie hatte recht getan, dies war das Herz ihrer neuen Heimatstadt. Die Brunnen glitzerten, die Löwen lächelten ... Durch den Admiralty Arch auf der anderen Seite konnte sie die Mall sehen, die zum Buckingham-Palast führte, wo der schüchterne König lebte und die Königin mit der sanften Stimme sich um die Prinzessinnen auf ihrer Keksdose kümmerte.
Sie neigte den Kopf nach hinten, um zu Nelson hoch oben auf seiner Säule hinaufzuschauen, zu diesem kleinen Mann, dem Lieblingshelden der Engländer. Er war ungeheuer tapfer gewesen ... Aber die Briten waren alle tapfer. Ihre jungen Mädchen schlugen einander mit Hockeystöcken grün und blau und weinten keine Träne; ihre Frauen waren in früheren Zeiten in wollenen Röcken durch die Urwälder marschiert, um die Heiden zum Wort Gottes zu bekehren.
Auch sie würde stark und tapfer sein. Sie würde die Prüfungen zu Weihnachten bestehen und abends wach bleiben, damit Heini reden konnte, wenn er das brauchte. Es war lächerlich zu glauben, daß ein Mensch mehr brauchte als vier Stunden Schlaf. Sie konnte alles schaffen, wenn sie nur wollte. «Der Wille muß nur geboren werden, damit er triumphieren kann.» Das hatte Ruth in einem Kalender gelesen und war sehr beeindruckt gewesen. Daran wollte sie sich halten.
Erst jetzt wandte sie sich dem Schreiben zu, das Mr. Proudfoot dem Paß beigelegt hatte, und sah, daß er sie am folgenden Nachmittag in seiner Kanzlei erwartete.
Proudfoot hatte es für das einfachste gehalten, mit Ruth persönlich zu sprechen, und hatte das Quin auch gesagt. «Es wäre am vernünftigsten, wenn ihr zusammen kämt, aber wir können wohl nicht vorsichtig genug sein.»
Denn auf die Einbürgerung folgte der nächste Schritt – die Nichtigkeitserklärung. Zu diesem Zweck war ein umfangreiches Dokument vorbereitet worden, das von beiden Parteien vor einem Notar unterzeichnet werden mußte. Diese eidesstattliche Erklärung sollte dann dem Gericht in der Hoffnung vorgelegt werden, daß sie in die Hände eines Richters gelangte, dem sie genügen würde, um die Ehe für nichtig zu erklären, ohne weitere Beweise zu verlangen. Ob es sich tatsächlich so entwickeln würde, war nicht vorauszusehen, da die Verfahrensordnung für die Nichtigkeitserklärung von Ehen mit im Ausland geborenen Staatsbürgern derzeit revidiert wurde.
Als Mr. Proudfoot Ruth zum erstenmal sah, stand sie mit dem Rücken zu ihm in seinem Vorzimmer und betrachtete ein kleines Aquarell, das dort an der Wand hing. Das Sonnenlicht fiel schräg durch das Fenster direkt auf ihr Haar, so daß er als erstes diese flammende Pracht sah und sich augenblicklich wappnete. Mr. Proudfoot war für weibliche Reize äußerst empfänglich und hatte einmal in der Great Portland Street seinen Wagen mitten in eine Telefonzelle gefahren, weil er nur Augen für ein Mädchen gehabt hatte, das gerade aus einem der Häuser kam. Er wußte, daß Enttäuschung wartet, wenn Frauen mit flammendem blonden Haar sich umdrehen. Bestenfalls bekam man Mittelmäßigkeit zu sehen, schlimmstenfalls eine scharfe, mißvergnügte Nase, einen verkniffenen Mund, denn Gott geht mit seiner Fülle haushälterisch um.
«Miss Berger?»
Ruth drehte sich um – und eine riesige Welle der Dankbarkeit überschwemmte Mr. Proudfoot, während gleichzeitig seine Bewunderung für Quin als hochherzigen Retter der vom Schicksal Geschlagenen deutlich zurückging. Es blieb nur Verwunderung darüber, daß Quin es so eilig hatte, eine Frau loszuwerden, auf die die meisten Männer sich gestürzt hätten.

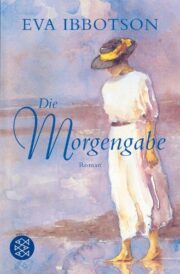
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.