«Ich bin nicht allein», sagte Quin und trat hinter sie, um sie in die Arme zu nehmen. «Und du auch nicht. Wir werden nie wieder allein sein.»
Als sie fertig gegessen hatten, öffneten sie die Balkontür und schauten auf die schlafende Stadt hinunter und auf den Fluß, der niemals schlief. In Quins Morgenrock gehüllt, in der Wärme seines Arms, atmete sie die Nachtluft in tiefen Zügen.
«Ich liebe diesen Fluß», sagte sie.
«Ich auch», antwortete Quin. «Er eignet sich auch gut, um eine Flaschenpost zu schicken. Morgen früh geh ich los und kaufe tausend Limonadenflaschen, stecke in jede ein Briefchen und werfe sie alle von der Brücke in den Fluß.»
«Und was schreibst du in den Briefen?»
Er drehte den Kopf, erstaunt über ihre Ahnungslosigkeit. «Deinen Namen natürlich. Was sonst?»
Immer noch Hand in Hand gingen sie ins Schlafzimmer zurück. «Es ist merkwürdig», sagte Ruth. «Ich dachte immer, die Liebe würde so sein wie der langsame Satz von Mozarts Sinfonia Concertante ... oder wie eines dieser Barockgemälde, die meine Mutter mir im Museum immer gezeigt hat, mit Putten und lichten Wolken und goldenen Strahlen ... oder vielleicht auch wie das Meer. Aber so ist sie nicht, nicht wahr?»
«Nein. Die Liebe ist nur sie selbst.»
«Ja.» Sie seufzte, drängte sich warm und entspannt und glücklich an ihn.
Er nahm sie in die Arme und sagte leise, aber klar in die Dunkelheit: «Meine Frau.»
26
Er hatte Ruth bald nach Tagesanbruch an der Ecke zu ihrer Straße abgesetzt. Jetzt, pünktlich um neun, parkte er den Crossley vor dem eleganten Juweliergeschäft Cavour und Stattersley, seit 1763 Hofjuwelier Seiner Majestät des Königs, und stieg langsam die Treppe hinauf.
Ganz plötzlich hatte ihn dieser Wunsch überkommen, ihr ein Geschenk zu machen, nutzlos und über alle Vernunft hinaus kostbar, um seiner Liebe Ausdruck zu verleihen. Ein überraschender Wunsch, denn es gab keine solche Tradition in Bowmont – keine Familientiara, die im Banktresor lag und an besonderen Festtagen herausgeholt wurde; kein Somerville-Halsband, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Seine Großmutter war Quäkerin gewesen und hatte an ihren Überzeugungen festgehalten; Frances besaß eine Kameenbrosche, die an Silvester das schwarze Chenillekleid schmückte und meistens etwas schief saß.
Doch seine Liebe zu Ruth – seiner Frau, die er eben erst gefunden hatte – wollte er mit einem Fanfarenstoß feiern, dessen Nachhall bis in kommende Generationen reichen würde. Die Zeiten waren dagegen, ebenso sein Gewissen. Als er durch die breite Tür trat, die ihm ein Page hielt, streckten ihm die Waisenkinder von Abessinien, die Arbeitslosen und Hungernden dieser Welt bettelnd die Hände entgegen, aber ohne Erfolg. Später würden sie vernünftig sein, er und Ruth; sie würden pflügen und säen und Wegerechte einräumen; sie würden für weitere singende Stallknechte bürgen, aber jetzt, in diesem Augenblick, würde er seiner Liebsten ein Geschenk senden, und sie würde aus ihrem Bett aufstehen und wissen, was es bedeutete.
Quin betrat also leichten Schrittes das elegante Geschäft, und Mr. Cavour, der ihn kommen sah, leckte sich, bildlich gesprochen, die Lippen.
«Woran hatten Sie denn gedacht?» fragte er, nachdem man Quin zu einem blauen Plüschsessel neben einem Rosenholzsekretär geführt hatte. In den Vitrinen lagen, angestrahlt wie die Schätze der Eremitage, Fabergé-Ostereier; Ohrgehänge mit funkelndem Kristallgeriesel; eine Schmetterlingsbrosche, die die spanische Exilkönigin getragen hatte. «Was für Steine beispielsweise?»
Quin lächelte, war sich wohl bewußt, daß er leicht absurd wirken mußte: Ein Mann, der bereit ist, sich für ein Geschenk in Unkosten zu stürzen, von dessen Art er nur eine verschwommene Vorstellung hat. Ja, an was für Steine hatte er eigentlich gedacht? Diamanten? Sindbad hatte ein ganzes Tal voller Diamanten entdeckt; sie steckten in den Köpfen von Schlangen und wurden von Adlern in die Lüfte getragen. Der Orlow-Diamant war aus dem Auge eines indischen Götzenbilds herausgebrochen worden ... der Großmogul, berühmtestes Juwel der Antike, gehörte zum Schatz des Schah Jahan.
Waren Diamanten das richtige für Ruth mit ihrer Wärme, ihrer Stupsnase, ihrer kindlich komischen Art? Oder war ihr Glanz zu eisig für sie?
«Wir haben einen wunderbaren Rubinschmuck da», sagte Mr. Cavour. «Die Steine stammen aus den Mogok-Minen; einzigartig. Die wahre Taubenblutfarbe. Die Großfürstin Tromatow hatte sie einer Amerikanerin verkauft, und sie sind gerade wieder auf den Markt gekommen.»
Quin überlegte. Mogok, in der Nähe von Mandalay ... Reisfelder ... er war dort gewesen, hatte nach einer früheren Expedition einen Abstecher dorthin gemacht und die Minen besichtigt. Warum nicht Rubine mit ihrem besonderen inneren Feuer?
«Oder würde Sie eher ein Halsband aus Perlen und Saphiren interessieren? Es gibt kaum etwas Ähnliches auf der Welt. Wir haben bereits einen Interessenten dafür, aber wenn Sie ein festes Angebot machen möchten ...» Er sah einen der Verkäufer an und schnippte mit den Fingern. «Gehen Sie hinunter zum Tresor, Ted, und holen Sie Nummer 509 herauf.»
Quins Gedanken gingen ihre eigenen Wege, er wußte nicht, mit welchem Ziel. Die profane Venus wurde immer reich behängt mit einem Perlennetz gemalt. Die himmlische Venus jedoch malten sie nackt, denn sie wußten, diese Weisen der Renaissance, daß die Nacktheit rein war. Beides war ihm recht: Ruth in ihrem Lodencape, mit Schmuck behangen; Ruth nackt um Mitternacht, einen Pfirsich essend.
Das Kästchen wurde gebracht, aufgeklappt. Das Halsband war super.
«Ja ... es ist sehr schön», sagte Quin geistesabwesend.
Und da tauchte es plötzlich auf, das Zeichen, der Hinweis – das, worauf er gewartet hatte: Ruth, wie sie barfuß und mit flatterndem Haar am Strand von Bowmont stand und ihm etwas zeigte, das sie in der Muschel ihrer Hand hielt. «Schauen Sie», sagte sie, «ach, schauen Sie doch!»
Er stand auf und tat das Halsband mit einer kurzen Geste ab. «Ich weiß jetzt, was es sein muß», sagt er. «Ich weiß es ganz genau.»
Was er danach zu tun hatte, war schnell erledigt. Dick Proudfoot war sonnenverbrannt und mit sich und der Welt zufrieden aus Madeira zurückgekehrt. Er hatte vier Aquarelle produziert, von denen nur drei ihm mißfielen. Jetzt blickte er auf das umfangreiche Dokument mit seinen Siegeln und Bändern hinunter – eine Kopie des ersten, die ihm die Sekretärin gerade hereingebracht hatte, als Quin unerwartet in der Kanzlei erschienen war – und fragte dann, den Kopf hebend: «Was hast du da gesagt?»
«Du hast mich doch genau verstanden. Zerreiß das Papier. Vergiß die Nichtigkeitserklärung. Ich bleibe verheiratet.»
Proudfoot lehnte sich in seinem Sessel zurück und faltete die Hände hinter dem Kopf. «So, so. Nun, ich kann nicht behaupten, daß ich überrascht bin.» Er grinste. «Erlaube mir, daß ich dir von Herzen Glück wünsche.»
Ihm fiel auf, daß er Quin seit langem nicht so entspannt und glücklich erlebt hatte. Er zog das umfangreiche Dokument zu sich heran, zerriß es und ließ es in den Papierkorb fallen.
«Ganz abgesehen von allem anderen ist das eine große Erleichterung – wir befanden uns nämlich auf ziemlich unsicherem Boden. Hast du vor, nach Bowmont zu ziehen?»
«Ja. Sie gehört dorthin – sie war nur ein paar Tage dort, aber alle erinnern sich an sie: der Schäfer, die Hausmädchen, es ist wirklich verrückt.» Ein flüchtiger Schatten fiel auf sein Gesicht. «Das Dumme ist nur, daß ich eine Expedition nach Afrika geplant habe.»
Doch noch während Quin sprach, wurde ihm klar, was er tun würde. Das Klima in den Ebenen war gesund; die Reise war nicht gefährlich – und im Notfall konnte Ruth immer in Lindi beim Commissioner und seiner Frau bleiben.
«Soll ich Ruth schreiben?»
«Nein, ich sage es ihr selber. Und vielen Dank für deine Bemühungen, Dick. Wenn du mir die Rechnung nach Chelsea schickst, dann erledige ich das noch, bevor ich reise.»
Er war schon an der Tür, als Proudfoot ihn zurückrief. «Hast du noch einen Moment Zeit?»
Obwohl Quin es eilig hatte, wegzukommen, nickte er. Dick ging zu einer Kommode an der Wand, zog eine Schublade auf, entnahm ihr ein kleines Aquarell: eine zarte, wie gefiedert wirkende Tamariske, jeder Pinselstrich wie ein Hauch, vor einem Hintergrund roter Geranien.
«Das hab ich in Madeira gemalt. Meinst du, es würde Ruth gefallen?»
«Bestimmt.»
«Gut, dann laß ich es rahmen und schicke es ihr.»
Draußen auf der Straße sah Quin auf seine Uhr. Ruth müßte sein Geschenk eigentlich inzwischen bekommen haben – Cavour hatte versprochen, es sofort zu schicken. Ein wenig schwindlig vom Schlafmangel und der Überzeugung, daß er ewig leben würde, steuerte er seinen Wagen in Richtung Museum. Es würde keine Schwierigkeiten bereiten, noch eine weitere Kabine auf dem Schiff zu buchen, aber er wollte doch Milner sofort Bescheid sagen. Und wie angenehm zu wissen, daß Brille-Lamartaine, sollte er nähere Erkundigungen einziehen, nichts als die Wahrheit erfahren würde. Denn er nahm ja tatsächlich eine Frau mit auf die Reise, eine seiner Studentinnen, eine junge Frau, die er leidenschaftlich liebte.
Ruth hatte nicht geglaubt, daß sie noch schlafen könnte, nachdem sie sich von Quin getrennt hatte. Sie hatte sich leise ins Haus geschlichen und war nur von dem Wunsch beseelt in ihr Bett geklettert, diese ganze herrliche Nacht noch einmal zu durchleben, doch sie war augenblicklich in einen tiefen, traumlosen Schlaf gefallen.
Als sie jetzt erwachte, hatte sich die ganze Welt verändert. Das Schlafzimmer mit der wild gemusterten braunen Tapete, das sie mit Tante Hilda teilte, hatte sie nie verlockt, ihren Blick schweifen zu lassen, jetzt jedoch konnte sie sich vorstellen, mit welcher Wonne der Designer seine Muster zu Papier gebracht hatte. Und Hilda selbst, die vor dem kleinen Spiegel stand und sich das dünne Haar bürstete, schien Ruth die Personifizierung des akademischen Ideals zu sein – ihr Leben lang einem Stamm Primitiver verpflichtet, den sie niemals kennengelernt hatte, ekstatisch angesichts einer abgebrochenen Pfeilspitze oder eines Trinkbechers. Was für eine prachtvolle Person Tante Hilda war, wie dankbar Ruth sein konnte, ihre Nichte zu sein!
Sie schwang die Beine aus dem Bett und lächelte den Schrumpfkopf an. Jetzt ging sie über die Keksdose unter den Dielenbrettern, in der ihr Trauring und ihre Heiratsurkunde lagen. Bald – vielleicht schon heute – konnte sie sie herausholen und ihrer Mutter zeigen.
«Ich bin verheiratet, Mama», würde sie sagen. «Ich bin mit Professor Somerville verheiratet, und ich liebe ihn abgöttisch, und er liebt mich.»
Sie schlüpfte in ihren Morgenrock und ging zum Fenster, und auch hier lachte ihr eine Schönheit entgegen, die sie nie zuvor wahrgenommen hatte. Gewiß, der Gasometer stand immer noch dort, aber ebenso die Platane im Nachbargarten, mit rußiger Rinde zwar und einem abgestorbenen Ast, jedoch in der ganzen Pracht der mutigen jungen Blättchen!
Auf der Treppe traf sie das finstere Fräulein Lutzenholler mit ihrem Kulturbeutel in der Hand. «Er ist im Bad», brummte sie.
Ruth brauchte nicht zu fragen, wen sie meinte. Es war immer Heini, der im Bad war. An diesem Morgen jedoch verteidigte sie Heini nicht, dazu liebte sie Fräulein Lutzenholler viel zu sehr, die mit allem so recht gehabt hatte: Die gesagt hatte, daß wir das verlieren, was wir verlieren wollen, das vergessen, was wir vergessen wollen ... die gesagt hatte, Frigidität habe damit zu tun, ob man einen Menschen liebe oder nicht. Ruth, in der Ekstase ihrer Nichtfrigidität, strahlte die Psychoanalytikerin an und hätte sie geküßt, wäre nicht das Oberlippenbärtchen gewesen und das Wissen, daß Fräulein Lutzenholler sich so früh am Morgen die Zähne noch nicht geputzt haben konnte.
«Beeil dich, Heini!» rief Ruth.
Der Gedanke an Heini ließ sie innehalten. Heini würde tief verletzt sein. Einen Moment lang verdunkelte eine Wolke ihre Freude. Aber nur einen Moment lang. Heini würde einen anderen Star finden – eine ganze Schar in den kommenden Jahren. Seine Liebe gehörte der Musik, und mit Recht – und das, was in der vergangenen Nacht geschehen war, konnte man nicht bedauern.
Ach, Quin, dachte sie und schlang die Arme um ihren Oberkörper, und Fräulein Lutzenholler, die voller Wut darauf wartete, endlich das Bad benützen zu können, sah sie verblüfft an und erinnerte sich, daß es etwas gab, dem sie in ihrem Beruf selten begegnete: Freude.
Ruth gab die Hoffnung auf das Badezimmer auf und ging in die Küche, wo sie alle seit Heinis Ankunft eine Extra-Zahnbürste aufbewahrten. Ihre Mutter war dabei, den Frühstückstisch zu decken, und Ruth blieb einen Moment an der Tür stehen und sah ihr zu. Leonie sah müde aus, ihr Gesicht hatte Falten, die noch nicht dagewesen waren, als sie Wien verlassen hatten, und in ihrem Haar waren graue Strähnen, aber ihre Tochter fand sie schön. Mit der Liebe, die Ruth einhüllte, mit der Wonne an die erinnerte Nacht stieg eine überwältigende Dankbarkeit in ihr auf; nun endlich würde sie ihren Eltern, Onkel Mishak helfen können.

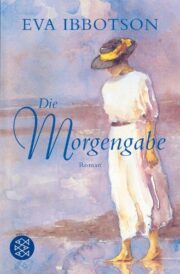
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.