Quin stand da und sah auf sie hinunter und konnte nur hoffen, daß das kleine Fingertier in ihren Armen ihre Seele in die Straßen von Belsize Park trug, in das Land, in dem nun alle Zuflucht gefunden hatten, die sie liebte.
3
Leonie Berger glitt vorsichtig aus dem Bett und drehte das Kopfkissen um, damit ihr Mann, der auf der anderen Seite der schmalen, durchgelegenen Matratze zu schlafen vorgab, den nassen Fleck, den ihre Tränen hinterlassen hatten, nicht bemerkte. Dann machte sie Morgentoilette und kleidete sich mit großer Sorgfalt an – Seidenstrümpfe, schwarzer Rock, weiße Bluse, hochhackige Schuhe –, weil sie Wienerin war und man auch dann noch auf sein Äußeres achtete, wenn die eigene Welt zusammengebrochen war.
Und dann begann sie, ein guter Mensch zu sein.
Leonie war sehr mutig gewesen, als sie Wien verlassen hatten. Sie hatte in ihrem Korsett versteckt eine Brillantbrosche mitgenommen, ein äußerst leichtsinniges Unterfangen. Sie war vernünftig und fürsorglich gewesen, denn das entsprach ihrer Natur, hatte dafür gesorgt, daß der eine Koffer, den ihr Mann mitnehmen durfte, alle Aufzeichnungen für sein Buch Die Säugetiere des Pleistozän enthielt, außerdem seine Magentabletten und die Nagelschere, mit der er auch seine Zehennägel schneiden konnte. Sie war ihrer Schwägerin Hilda gegenüber, die mit einer Arbeitserlaubnis emigrierte und auf dem Weg zur Kanalfähre dauernd über ihre aufgegangenen Schnürsenkel stolperte, von einer Engelsgeduld gewesen, und sie hatte das Kind einer jungen Mutter, die auf der Flucht war wie sie, gehalten, während diese sich an der Reling übergeben mußte. Selbst angesichts der Unterkunft, die ihnen von ihrem Bürgen, einem entfernten Verwandten besorgt worden war, hatte Leonie nur ein wenig gemurrt. Die Räume in der obersten Etage eines schäbigen Mietshauses in Belsize Close waren kalt und düster, die Möbel waren abscheulich, die Gemeinschaftsküche ein Graus, aber sie waren billig.
Doch damals hatte sie eben noch geglaubt, Ruth warte in dem Studentenlager an der Südküste auf sie. Seit der Brief von der Hilfsorganisation der Quäker eingetroffen war, in dem man ihnen mitgeteilt hatte, daß Ruth nicht mitgekommen war, hatte Leonie begonnen, gut zu sein.
Das hieß, niemals auch nur ein einziges Wort der Kritik oder Beschwerde verlieren. Das hieß, mit Vergnügen den Geruch langsam verrottenden Blumenkohls aus der Gemeinschaftsküche einatmen, die eine Psychoanalytikerin aus Breslau mit ihnen teilte. Das hieß, die räudigen Straßenkater bewundern, die in dem sogenannten Garten, der in Wirklichkeit nur ein Schutthaufen war, heulten und jaulten. Das hieß, glücklich und zufrieden sein mit der zischenden Gasheizung, die die Münzen nur so schluckte, dafür aber nur Abgase und blaue Flammen von sich gab. Das hieß, kein Lebewesen verärgern, die Hausfliegen dulden, mit Dankbarkeit die braune Soße schlürfen, die in Flaschen abgefüllt war und sich Kaffee nannte. Das hieß, Gott und allen guten und bösen Geistern zu jeder Tages- und Nachtzeit versichern, daß sie niemals klagen würde, ganz gleich, was geschah, wenn nur Ruth gesund und unversehrt war und bald zu ihnen kommen würde.
Um halb acht hatte Leonie das Frühstück für ihre Familie fertig – Brote, die mit Margarine bestrichen waren, eine Substanz, die keiner von ihnen je zuvor gekostet hatte –, und danach machte sich Hilda mit rotgeränderten Augen auf den Weg zu ihrer Arbeit als Hausgehilfin bei einer Mrs. Manfred in Golders Green. Wäre Leonie nicht von ihrer Angst um Ruth besessen gewesen, so hätte sie tiefes Mitleid mit ihrer Schwägerin empfunden, die dauernd von Mrs. Manfreds Mops gebissen wurde und einfach nicht glauben konnte, daß eine Badewanne, wenn sie saubergemacht war, auch noch getrocknet werden mußte; so aber war sie heilfroh, daß Hilda nicht zu Hause bleiben konnte, um ihr im Haushalt zu «helfen».
Um acht Uhr marschierte Onkel Mishak mit dem englischen Lexikon in der Manteltasche den Hügel hinauf, um sich in die lange Schlange der Ausländer vor dem Rathaus in Hampstead einzureihen, die täglich auf Nachricht von Verwandten warteten und auf alle Arten von Genehmigungen – und überall auf seinem Weg wurde der untersetzte kleine Mann, der hin und wieder stehenblieb, um in einem Garten einen Rosenstrauch zu bewundern oder einem streunenden Hund ein Wort zu gönnen, von Bekannten gegrüßt, die er dank seiner freundlichen Art schon in den zehn Tagen des Exils gefunden hatte.
«Schon was gehört?» fragte der Mann im Tabakskiosk. Und als Mishak den Kopf schüttelte, meinte er: «Vielleicht hören Sie heute was. Es kommen ja jeden Tag welche an. Sie wird schon kommen, warten Sie nur.»
Die Blumenverkäuferin mit der Feder im verbeulten Hut, der Mishak noch nie etwas abgekauft hatte, riet ihm, nur den Kopf nicht hängen zu lassen; ein Wermutbruder, mit dem er sich eines Nachmittags eine Parkbank geteilt hatte, blieb stehen, um sich nach Ruth zu erkundigen.
Während Onkel Mishak so den Hügel hinauftrabte, ging ihn Kurt Berger in gerader Haltung hinunter, wobei er sich zwang, seinen Spazierstock zu schwingen. Er war auf seinem täglichen Gang zum Bloomsbury House, wo eine Gruppe Quäker, Sozialarbeiter und Beamte sich bemühten, den Enteigneten und Vertriebenen neue Orientierung zu geben – und auf seinem Weg durch die grauen Straßen, deren Steine selbst von Heimweh durchtränkt schienen, lüftete er immer wieder den Hut, um andere Flüchtlinge zu grüßen, die ihren täglichen Erledigungen nachgingen.
«Haben Sie Nachricht von Ihrer Tochter?» erkundigte sich Dr. Levy, der bekannte Herzspezialist, der seine Tage in der öffentlichen Bibliothek zubrachte, um sich auf ein zweites medizinisches Examen vorzubereiten, in Englisch diesmal.
«Und – haben Sie etwas gehört?» fragte Paul Ziller, der Leiter des Ziller-Quartetts. Er hatte keine Arbeitserlaubnis, sein Quartett hatte sich aufgelöst, aber jeden Tag ging er ins Jewish Day Centre, um in einem freien Garderobenraum zu üben, und jeden Abend warf er sich in seinen Smoking, um in einem ungarischen Restaurant für sein Abendessen Zigeunermusik zu machen.
In der düsteren Wohnung allein zurückgeblieben, hielt Leonie weiterhin an ihrem Vorsatz fest, nur gut zu sein. Und Güte zu zeigen, gab es reichlich Gelegenheit, während sie ihrer Hausarbeit nachging. Angesichts der dicken Fettschicht, den der übergekochte Eintopf der Psychoanalytikerin auf dem Herd hinterlassen hatte, wäre sie normalerweise wutschnaubend zu dieser in den zweiten Stock hinuntergestürmt. Statt dessen jedoch wischte sie die Bescherung ohne ein Wort auf. Das Badezimmer, das von allen Hausbewohnern benutzt wurde, bot nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Tugendhaftigkeit. Die Badewanne hatte einen schwarzen Rand, die triefnasse Badematte lag zusammengeknüllt in einer Ecke ... und Miss Bates, eine Kindergärtnerin, die einzige überlebende Engländerin in Nummer 27, hatte ein ganzes Sortiment tropfender Hemdhosen an einem durchsackenden Stück Schnur aufgehängt.
Das alles war unwichtig. Voll der Liebe zu Miss Bates, voll der Hoffnung, daß die Gute bald einen Ehemann finden würde, wrang Leonie die Hemdhosen aus, machte die Badewanne sauber. Sie hatte ihr Leben lang Personal gehabt, aber sie scheute die Arbeit nicht. Alles, was sie jetzt tat, war Opfergabe an Gott: an den katholischen Gott ihrer Kindheit, an den jüdischen Gott, dessentwegen all diese verwirrten Menschen durch die Straßen NordWest-Londons irrten – an jeden beliebigen Gott, völlig egal, Hauptsache, er brachte ihr ihr Kind zurück.
Um zwölf Uhr dann schminkte sie sich frisch und machte sich auf den Weg zum Tea-Room Willow. «Schlechte Nachricht, wie mir scheint», sagte Miss Maud, die gerade die Zuckerdosen füllte und durch das Fenster Leonie Berger beobachtete, die langsam über den Platz kam. Selbst aus der Ferne war leicht zu sehen, wie behutsam sie einen Fuß vor den anderen setzte, wie höflich sie mit den Tauben sprach, die ihren Weg kreuzten.
«Schlechte Nachrichten», sagte auch ihre Schwester, Miss Violet, und trug ein Tablett mit leeren Tassen in die Küche, wo Mrs. Burtt ihre Arme aus dem warmen Spülwasser zog und sagte, Hitler könnte was erleben, wenn sie ihn je erwischen sollte.
Miss Maud und Miss Violet Harper hatten das Willow vor fünf Jahren eröffnet, als sich herausstellte, daß ihr Vater, der General, nicht so gut für sie vorgesorgt hatte, wie sie gehofft hatten. Es war ein hübsches Lokal an der Ecke eines kleinen Platzes hinter der Belsize Lane, und sie hatten es mit einem gefälligen blau-weißen Porzellan mit Weidenmuster, mit blau-weiß karierten Vorhängen und einer Keramikkatze auf dem Fensterbrett gemütlich eingerichtet. Dazu erzogen, Ausländer bestenfalls als Pechvögel zu betrachten, hatten sich die Damen den Ansprüchen der Flüchtlinge, deren Zahl im Viertel ständig wuchs, standhaft widersetzt. Mochten andere Betriebe Torten mit fremdartigen Namen servieren und über alles und jedes Schlagsahne kippen, Zeitungen an Haltern zur Verfügung stellen und Gespräche quer durch das Lokal gestatten – in ihrem Tea-Room kam so etwas nicht in Frage. Da servierte man den Gästen scones und Sandkuchen und zum Mittagessen Rührei auf Toast, aber niemals etwas, das roch – und jeder, der länger als eine halbe Stunde bei einer Tasse Kaffee saß, wurde zuerst von Violet angehüstelt und, wenn das nichts half, lauter und deutlicher von der couragierteren Maud.
Und dennoch hatte sich bis zum Sommer 1938, als sich zu den Flüchtlingen aus Nazi-Deutschland entwurzelte Österreicher gesellten, die Einstellung der beiden Damen fast unmerklich geändert. Konnte man denn Dr. Levy mit seinem Walroßschnauzbart und den klugen braunen Augen wirklich anhüsteln, nachdem er Violets Schleimbeutelentzündung diagnostiziert hatte? Konnte man es Mr. Ziller übelnehmen, wenn er sich selbst auf den Arm nahm und vorführte, wie er einer Amerikanerin mit defektem Hörgerät auf seiner Geige Schwarze Augen vorspielte?
Konnte man Mrs. Berger gegenüber kühl bleiben, die gleich an ihrem ersten Tag in England mit ihrem distinguiert aussehenden Mann und ihrem reizenden alten Onkel ins Café gekommen war und den Sandkuchen gelobt und ihnen Fotografien von ihrer hübschen, stupsnasigen Tochter gezeigt hatte? Ruth würde kommen und hier studieren, hatte sie erzählt; und bald würde auch ihr Freund, ein genialer Konzertpianist, ihr folgen. Die Veränderung, die seit jenem Tag mit Leonie Berger vorgegangen war, hatte selbst die beiden Generalstöchter erschüttert, obwohl sie wahrhaftig an Geschichten von Schmerz und Verlust gewöhnt waren.
Leonie betrat das Café, nahm ihren Weg zu dem Stuhl, den Paul Ziller ihr herauszog, nickte dem Schauspieler von der Wiener Burg zu, der alten Mrs. Weiss mit ihrer Federtoque, der Engländerin mit dem Pudel ...
Dr. Levy legte sein Buch über Die Erkrankungen des Knies aus der Hand, das er vor zwanzig Jahren mühelos verstanden hätte, das jedoch einem Herzspezialisten, der kein Jüngling mehr war und nicht gefrühstückt hatte, in Englisch etwas Mühe machte.
«Ich habe gehört, daß jetzt viele Studententransporte in Schottland ankommen», sagte er.
«Ja, ich danke Ihnen», antwortete Leonie.»Mein Mann erkundigt sich bereits.»
Maud stellte Leonie unaufgefordert ihre gewohnte Tasse Kaffee hin. Der Schauspieler vom Burgtheater – ein blonder, aufregend gutaussehender Mann, der wegen seiner politischen Ansichten, nicht wegen seiner Rasse das Land hatte verlassen müssen – bemerkte, viele Leute flüchteten jetzt über Portugal, was von dem Ehepaar aus Hamburg, das an einem Ecktisch saß, bestätigt wurde.
Paul Ziller, unsagbar einsam und allein ohne die drei Männer, mit denen er über ein Jahrzehnt lang Musik gemacht hatte, sagte nichts, tätschelte nur Leonies Hand. Er erinnerte sich des komischen kleinen Mädchens, das eines Abends, als das Quartett Kurt Berger zum Geburtstag ein Ständchen gebracht hatte, wie der Wind aus seinem Kinderbett geklettert war und im Nachthemd in den Salon gelaufen kam.
Mrs. Weiss, deren kastanienbraune Perücke unter ihrem Hut etwas schief saß, begann eine langatmige und verwirrende Geschichte von einem verschwundenen Mädchen, das gänzlich unerwartet in einem Güterzug nach Dieppe wiederaufgetaucht war. Die Zweiundsiebzigjährige, von den Stammgästen des TeaRooms als eine wahre Geißel Gottes betrachtet, war von ihrem Sohn, einem wohlhabenden Rechtsanwalt, aus dem Dorf in Ostpreußen geholt worden, in dem sie ihr Leben lang gelebt hatte. Der Anwalt wohnte jetzt in einem eleganten Herrenhaus mit Garten und Seerosenteich in Hampstead und hatte eine Engländerin zur Frau, die ihre schreckliche Schwiegermutter jeden Morgen mit einem Taschengeld versehen, mit dem sie ihr Gewissen beruhigen wollte, ins Willow abschob. Wenn Mrs. Weiss die Worte sprach:»Darf ich Sie zu einem Stück Kuchen einladen?», packte die anderen Stammgäste das Grausen. Sie wußten, wenn sie annahmen, würden sie sich Mrs. Weiss' endloses Lamento über ihre böse Schwiegertochter anhören müssen, die ihr nicht erlaubte, Zwiebeln zu braten, mit den Dienstmädchen zu plaudern oder im Haushalt zu helfen.

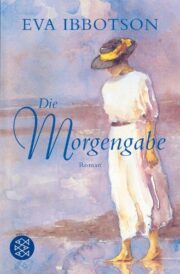
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.