Plötzlich war mein Arm frei. Ich griff hastig nach oben und umklammerte das Kopfende des Betts. Mit einer gewaltigen Kraftanstrengung gelang es mir, mich sq weit hochzuziehen, daß ich mich aufsetzen konnte. Aber immer noch lastete der beklemmende Druck auf mir. Er war wie ein gewaltiger Sog. Ich kämpfte dagegen an, schnappte gierig nach Luft, um den Alp abzuwehren. Weit aus dem Bett hängend, fuchtelte ich in der Finsternis herum, traf mit einer Hand die Wand und schlug rein zufällig auf den Lichtschalter.
Im selben Moment, als das Licht anging, wich schlagartig der Druck von mir, und ich fiel zu einem keuchenden, japsenden Bündel zusammen.
Ich hatte so stark geschwitzt, daß mein Pyjama ganz feucht war. Und jetzt begann ich zu frieren, begann vor Erschöpfung und Kälte so heftig zu zittern, daß das Bett wackelte. Lange hockte ich an das Kopfende des Betts gelehnt, rieb mir die Arme und stampfte mit den Füßen, um wieder warm zu werden, und überlegte dabei, was eigentlich geschehen war.
Ich konnte mich nicht erinnern, was mich geweckt hatte; ob es ein Traum gewesen war oder die Kälte oder einfach die ungewohnte Umgebung. Oder etwas anderes.
Und dieser schreckliche Druck. Hatte ich ihn mir eingebildet? War vielleicht alles nur ein Traum gewesen, der bis zu dem Moment gedauert hatte, als ich im Schlaf den Lichtschalter gefunden hatte?
Ich konnte es nicht glauben. Es war mir nicht vorgekommen wie ein Traum. Es war von einer unheimlichen Realität gewesen. Als ich die Decken bis zu Schultern und Hals heraufzog, spürte ich, wie schwer sie waren. Mehrere Wolldecken, eine Steppdecke und ein großes Federbett — kein Wunder, daß ich mich wie erdrückt gefühlt hatte.
Natürlich! Das war es! Ich lachte leise, um mir selbst Mut zu machen. Zu Hause schlief ich immer nur mit einer leichten Decke; unter dem Gewicht dieses Bettzeugs mußte ich geträumt haben, daß eine unheimliche Macht mich ersticken wollte. Wie seltsam ist diese Dämmerzone zwischen Schlafen und Wachen. Wie beängstigend war es gewesen, zu erwachen und nicht zu wissen, wer ich war und wo ich mich befand. Aber jetzt verständlich im Licht der Deckenlampe. Ich hatte einen Alptraum gehabt; er war mir nur realer erschienen als die meisten. Selbst jetzt noch, während ich im hellen Zimmer im Bett saß, spürte ich Reste der Furcht, die mich beim Erwachen überfallen hatte. Aber alles Einbildung. Nichts real.
Ich griff zum Schalter, um das Licht auszumachen, und hielt inne. Ohne zu wissen warum, drehte ich den Kopf und blickte über die Schulter.
Der Spiegel über dem Kamin. Was hatte er Merkwürdiges an sich?
Lange blieb ich so sitzen und blickte stirnrunzelnd zum Spiegel; fragte mich, was mich veranlaßt hatte, zu ihm hinüberzusehen, warum ich den Blick jetzt nicht von ihm wenden konnte. Und während ich ihn unverwandt anstarrte, war mir, als hörte ich eine feine Stimme, die mir zuflüsterte, ich dürfe nicht wegsehen.
Aber warum? Es war doch ein ganz gewöhnlicher Spiegel. Alt, eine Antiquität vielleicht, mit einem glanzlosen vergoldeten Rahmen. Nichts Ungewöhnliches war an ihm. Und er zeigte nichts als ein Bild dieses Zimmers mit der offenen Schranktür im Mittelpunkt.
Und doch hielt er mich fest, und ich schaute ihn so fasziniert an, als wüßte ich, was ich in ihm suchte. Als schwebe die Antwort auf die Frage, was für eine zauberische Macht dieser Spiegel besaß, am innersten Rand meines Bewußtseins. Beinahe konnte ich sie fassen…
Endlich schüttelte ich abwehrend den Kopf, befreite mich aus dem Bann und glitt wieder unter die Decken, ohne das Licht zu löschen. Der lange Flug und die Zeitverschiebung hatten mir mehr zugesetzt, als ich geglaubt hatte.
Ich zwang mich zu einem Lächeln und versicherte mir, während ich mich im tröstlichen Schein des Lichts ausstreckte, daß morgen alles wieder ganz normal sein würde.
Als ich am Morgen erwachte, roch ich den Duft von gebratenem Speck und frischem Kaffee, und nach einem Blitzbesuch im eiskalten Badezimmer sauste ich in Jeans und Pullover nach unten, wo mich ein angenehm warmes Wohnzimmer und ein gedeckter Tisch erwarteten. Zwar vertrieb das Sonnenlicht, das freundlich durch das Fenster strömte, alle Hirngespinste der vergangenen Nacht, doch es blieb ein Gefühl unerklärlichen Unbehagens. Ich hatte kaum geträumt und konnte mich nur an wenige zusammenhängende Traumfetzen erinnern. Als ich im sonnenhellen Zimmer erwacht war, hatte ich mich erfrischt und ausgeruht gefühlt; um so bestürzender war es zu entdecken, daß das Haus mich noch immer nicht aus seinem unheimlichen Bann entlassen hatte.
«Ist das hier das einzige Zimmer im Haus, das ihr bewohnt, Großmutter?«fragte ich, während ich Butter auf meinen Toast strich.
«Ja, Kind. Dieses Zimmer und unser Schlafzimmer. Den früheren Salon benützen wir schon seit Jahren nicht mehr. Wir brauchen ihn nicht. Er dient uns eigentlich nur noch als Abstellraum. «Ich nickte. Es war ein gemütliches Zimmer. Wir saßen an dem kleinen Eßtisch vor dem Fenster, das zum Garten hinausblickte. Aber ein Garten war das eigentlich gar nicht. Vom Fenster bis zu der hohen Mauer am anderen Ende konnten es höchstens zehn Schritte sein. Man hätte mit einem einzigen großen Sprung über den ganzen Garten setzen können. Der Boden war holprig mit Backstein gepflastert. Es gab keinen Rasen und keine Blumenbeete, nur am Fuß der beiden Mauern je einen Streifen Erde, aus der Rosenbüsche wuchsen — oder einmal gewachsen waren; jetzt waren sie nur noch dürre Skelette. In die Mauer am Ende des Gartens war ein Tor eingelassen, das in eine kleine Gasse und zu dem auf der anderen Seite liegenden freien Feld führte.»Blühen die Rosen im Sommer, Großmutter?«
«Nein, Kind. In diesem Garten will einfach nichts gedeihen. Das war schon immer so. Von Anfang an. Diese Rosenbüsche waren schon hier, als wir hier einzogen.«
«Hast du mal versucht, sie zum Blühen zu bringen?«Ich führte meine Tasse zum Mund und blickte geistesabwesend zu den kahlen Büschen hinaus.
«Ja, sicher, am Anfang schon, aber es war sinnlos. Es ist wahrscheinlich schlechter Boden. «Sie sah mich an.»Weißt du, es ist komisch, jetzt, wo ich darüber nachdenke — nie ist uns in diesem Garten etwas gewachsen. Und uns ist auch kein Haustier geblieben, ob Hund oder Katze. Immer sind sie uns weggelaufen. Das muß am Boden liegen, sagte dein Großvater immer. «Ihre Worte weckten ein seltsames Gefühl in mir, aber ich schüttelte es ab und sagte:»Wie lange lebt ihr hier schon allein, du und Großvater?«
«Dein Onkel William ist als letzter ausgezogen. Das muß jetzt zwanzig Jahre her sein oder länger. Danach brauchten dein Großvater und ich die anderen Räume nicht mehr. Aber die Möbel sind noch alle da, so wie sie waren, als ich vor zweiundsechzig Jahren hier eingezogen bin.«
«Im Ernst? Das alles hier ist noch von damals?«
«Jedes Stück. Auch das Bett, in dem du heute nacht geschlafen hast. Das kam alles so um 1880 ins Haus.«
«Du hast ein paar wertvolle alte Dinge hier, Großmutter.«
«Ja, ich weiß. Und da liegen mir Elsie und William dauernd in den Ohren, daß ich alles verkaufen und in eine Wohnung ziehen soll.
Das kann ich doch nicht! Das Haus steckt für mich voller Erinnerungen. Niemals könnte ich einfach von hier fortgehen. Das Haus ist ein Teil von mir, Andrea.«
Ich sah wieder zum Fenster hinaus, betrachtete den leuchtend blauen Himmel und versuchte mir vorzustellen, wie es sein mußte, zweiundsechzig Jahre lang im selben 'Haus zu leben. Die längste Zeit, die ich mit meinen Eltern irgendwo gelebt hatte, waren zehn Jahre gewesen, in einem Haus in Santa Monica, und wir hatten gemeint, es wäre eine Ewigkeit.
«Dieses Haus hat viel erlebt, Andrea, und es hat auch an Unglück nicht gefehlt.«
Ich wandte mich wieder meiner Großmutter zu. Sie wich meinem Blick aus.»Aber es hat natürlich auch viel Freude gesehen. In jeder Familie gibt es beides, nicht wahr?«Der Rest des Morgens verging mit Aufräumen, Abwaschen und Großmutters Gesprächen über die Misere der britischen Wirtschaft. Um ein Uhr kamen Elsie und Ed, durchgefroren und mit roten Nasen.
«Es wird wieder kälter«, bemerkte Elsie und eilte zum Kamin.»Hoffentlich frierst du nicht, Andrea.«
«Nein, nein, ich hab mich warm angezogen. Wie lang ist die Besuchszeit?«
«Nachmittags nur eine Stunde. Aber das ist auch genug für deinen Großvater. Wir wollen ihn nicht ermüden. Und abends kann man anderthalb Stunden bleiben.«
«Geht ihr beidemale?«
«Nein, Kind. Abends geht William mit seiner Frau. Wir können nachmittags gehen, weil Ed schon in Rente ist. William und May gehen abends nach dem Essen. Manchmal geht auch Christine nach der Arbeit zu Großvater.«
Über Christine wußte ich ein wenig. Sie war sieben Jahre jünger als ich und arbeitete als Stenotypistin in einer Fabrik in der Nähe. Elsies Kinder, mein Vetter Albert und meine Cousine Ann, lebten nicht mehr in Warrington. Ann war nach Amsterdam gegangen, und Albert hatte geheiratet und lebte jetzt in Morecambe Bay an der Irischen See.
Geradeso wie meine Mutter ihren Verwandten über besondere Ereignisse in unserer Familie geschrieben hatte, meinen College-Abschluß zum Beispiel und Richards Entschluß, nach Australien zu gehen, hatte unsere englische Verwandtschaft uns über die Jahre von ihrem Leben berichtet. Aber ich kannte Christine, Albert und Ann natürlich nur von Fotos, und abgesehen von einigen Äußerlichkeiten — daß Ann in Amsterdam als Malerin arbeitete, Albert und seine junge Frau eine kleine Tochter hatten und Christine hier in Warrington in ihrer eigenen kleinen Wohnung lebte — wußte ich nichts über sie.
Und ich wollte auch gar nichts wissen. Ich war so lange ohne Verwandtschaft ausgekommen, da hatte ich jetzt keinerlei Bedürfnis, Beziehungen herzustellen. In wenigen Tagen würde ich sowieso nach Los Angeles zurückkehren, und diese Menschen hier würden wieder aus meinem Leben verschwinden.
«Deine Mutter und ich waren zwei schlimme Mädchen«, sagte Elsie, als ich mich zu ihr an den Kamin setzte.»Mir ist schleierhaft, wie der arme William es mit uns ausgehalten hat. Wir waren beide älter, weißt du, und wir haben ihn furchtbar tyrannisiert. «Sie lachte.»Ach, wie schade, daß Ruth nicht mitkommen konnte. Aber so eine Fußgeschichte ist langwierig und schmerzhaft, nicht wahr? Weißt du eigentlich, Andrea, daß ich dich als Baby eine Weile versorgt habe? Deine Mutter wurde kurz nach deiner Geburt krank und mußte noch einmal ins Krankenhaus, und da hab ich mich um dich gekümmert. Das war schön. Es war, als wärst du mein Kind. Ich hatte damals noch keine Kinder. Albert wurde erst ein Jahr später geboren.«
So erzählte sie eine Weile weiter, bis es Zeit war zu gehen. Dankbar für die Wollmütze und die Handschuhe, die Elsie mir mitgebracht hatte, mummelte ich mich richtig ein und wappnete mich gegen die Kälte, die uns draußen erwartete.»Und wenn du zurückkommst, gibt es einen guten Fisch, Kind«, sagte Großmutter, die uns zur Tür begleitete.»Ich kann heute nicht mitkommen, Andrea. Es ist zu kalt für meine alten Knochen. Vielleicht am Sonntag, wenn ich mich wohl genug fühle. «Als ich Elsie und Ed hinterhergehen wollte, die schon auf dem Weg zum Wagen waren, hielt sie mich fest.»Er ist ein Fremder für dich, Andrea, aber daran solltest du dich nicht Stören. Er ist ein Townsend genau wie du eine Townsend bist. Denk immer daran, daß er der Vater deiner Mutter ist. Er ist dein Großvater, und er braucht dich jetzt. Er braucht uns alle. «Ich nickte stumm und lief zum Wagen hinaus.
Das Städtische Krankenhaus von Warrington wirkte bei Tag genau so mächtig und bedrohlich wie am Abend zuvor, als Elsie es mir gezeigt hatte. Hier, zwischen diesen dicken roten Backsteinmauern, hatte ich meinen ersten Schrei getan. Und nun, siebenundzwanzig Jahre später, war ich zurückgekehrt, auf einer Art unfreiwilliger Pilgerfahrt zu meinen Wurzeln. Das erste, was ich wahrnahm, als wir durch die Schwingtür des Krankenhauses traten, war der entsetzliche Geruch. Er war so ekelhaft und durchdringend, daß mir beinahe übel wurde. Ed und Elsie schienen ihn gar nicht zu bemerken. Sie waren ganz damit beschäftigt, Handschuhe, Mützen und Schals abzulegen und ihre Mäntel aufzuknöpfen. Ich machte es ihnen nach und bemühte mich, den Gestank zu ignorieren, während ich ihnen durch den langen Korridor zur Station folgte.
Hier erwartete mich der nächste Schock: Das Krankenzimmer war ein großer düsterer Raum mit nacktem Holzfußboden und kahlen weißen Wänden. Zwanzig Betten standen nebeneinander an jeder der beiden Längswände, am einen Ende des Raums war ein Waschbecken, am anderen ein altmodischer Fernsehapparat. Die Vorhänge an den Fenstern waren trist, in einer Ecke stand ein Stapel Klappstühle.
Dort nahm Ed drei Stühle, klappte sie auf und stellte sie zu beiden Seiten des Betts auf, das der Tür am nächsten stand.

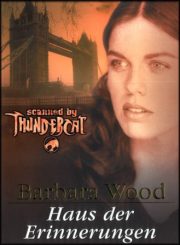
"Haus der Eriinnerungen" отзывы
Отзывы читателей о книге "Haus der Eriinnerungen". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Haus der Eriinnerungen" друзьям в соцсетях.