»Ich weiß nicht, was ich denken soll«, sagte Mary. »Es ist, als ob - als ob alles anders geworden wäre.« Sie dachte an Mike und Germaine und ihre Eltern, und an ihr eigenes Leben. »Nichts ist mehr so, wie es war.«
»Das ist richtig, Kind, und nichts im Leben kann für immer so bleiben, wie es ist, so sehr wir uns das auch manchmal wünschen. Als ich damals Sam in der Küche liegen sah, so friedlich, als hätte er sich hingelegt, um ein Nickerchen zu machen, da hatte ich ein Gefühl, als stünde ich am Rand eines schwarzen Abgrunds. Und manchmal, wenn ich es zulasse, kommt dieses Gefühl wieder, und dann kommen mir lauter dumme Gedanken. Ich zerfließe vor Selbstmitleid und sage mir, daß es keinen Sinn hat weiterzumachen. Aber -«
Mary sah erstaunt, daß Gloria die Tränen in die Augen getreten waren. Impulsiv beugte sie sich vor und legte ihre Hand auf Glorias Arm. Die lächelte und drückte ihr die Hand.
»Ich gehöre nicht zu den Frauen, die stumm in sich hineinweinen können, ohne eine Träne zu vergießen. Ich heule und schniefe und kriege ein total verschwollenes Gesicht, wo ich doch von Natur aus schon nicht zu den Schönsten gehöre.« Sie lachte ein wenig. »Ach, du hast schon ausgetrunken. Möchtest du noch eine Tasse?«
Zweieinhalb Stunden später stellte Mary den Chevrolet in der Auffahrt ab, sperrte leise die Haustür auf und trat in den dunklen Flur. Auf Zehenspitzen schlich sie zur offenen Tür des Wohnzimmers, aus dem gedämpftes Licht fiel. Sie war nicht überrascht, ihren Vater dort auf dem Sofa sitzen zu sehen, allein, ein Glas in der Hand. Sein Gesicht war halb im Schatten, die Schultern hingen schlaff nach vorn. Er sah alt und verbraucht aus.
»Daddy!« sagte sie leise.
Er zuckte ein wenig zusammen und sah auf.
Mary trat zaghaft einen Schritt ins Zimmer. Er stellte sein Glas auf den Tisch und sah ihr stumm entgegen. Sie rannte zu ihm, warf sich neben ihn aufs Sofa und schlang die Arme um seinen Hals.
»Ach, Daddy«, murmelte sie. »Es tut mir leid. Es tut mir so leid.«
Sie sprachen bis weit nach Mitternacht miteinander. Er sprach von seiner Beziehung zu Gloria und dann von jenen Dingen in seinem Leben, die er außer dieser Frau bisher keinem Menschen anvertraut hatte.
Ted McFarland glaubte, daß er in einem Zelt am Stadtrand von Tuscaloosa zur Welt gekommen war, aber er war nicht sicher. Seine früheste Erinnerung galt einer stickig heißen Nacht in einem heruntergekommenen Holzschindelhaus, wo es nach Alkohol stank und aus einem Nebenzimmer die gequälten Schreie einer Frau drangen. Er hockte auf dem nackten Holzfußboden, und im milchigen weißen Licht ging ständig ein großgewachsener, hagerer Mann hin und her und murmelte unablässig den Namen des Herrn. Flüsternde Frauen tauchten flüchtig aus den Schatten und verschwanden wieder, und am Ende dieser langen, heißen Nacht traten sie laut klagend mit einem leblosen Bündel auf den Armen aus dem Nebenzimmer. So war Teds Mutter gestorben.
Hoseah McFarland war Wanderprediger. Nach dem Tod seiner Frau hatte er seine wenigen Habseligkeiten zusammengepackt und war mit seinen Söhnen durch die Südstaaten gezogen. Sie lebten in Zelten, und während Hoseah, der Verkünder der frohen Botschaft, den Sündern dieser Welt mit Hölle und Verdammnis drohte, mußten seine Söhne mit dem Hut herumgehen, der unweigerlich bis zum Rand voll wurde. Als Ted dreizehn war, drückte ihm sein Vater ein Paar Krücken in die Hand, zeigte ihm, wie er ins Zelt zu hüpfen hatte und nach der Predigt die Krücken wegwerfen und nach vorn, zum Podium, stürzen mußte, um Gott und Hoseah McFarland für das Wunder zu danken, das an ihm geschehen war.
Ted machte seine Sache ausgezeichnet. Die armen Schwarzen und das >weiße Pack< spendeten, was sie hatten. Hoseah wurde ein wohlhabender Mann. Und wenn Ted nach der
Predigt einmal in den privaten Teil des Zeltes vordrang, um sich ein Wort der Anerkennung von seinem Vater zu holen, wurde er nicht eingelassen, weil Hoseah sich höchstpersönlich um das Seelenheil einer jungen Dame bemühte.
Eines Abends dann war im Zelt Feuer ausgebrochen. Hoseah McFarland konnte sich retten, aber viele Menschen wurden in der allgemeinen Panik getötet, und einer von Teds kleinen Brüdern wurde zu Tode getrampelt. Ted war um sein Leben gelaufen und auf den ersten Güterzug gesprungen, der an den Baumwollfeldern vorbeigerattert war.
Er hatte sich auf diese Weise bis nach Chicago durchgeschlagen und sich dort mit kleinen Diebstählen und Betrügereien über Wasser gehalten. Doch 1932, mitten in der Depression, war er von der Polizei bei einem Überfall auf einen alten Mann geschnappt und in ein katholisches Heim für streunende Jungen gesteckt worden.
Und dort hatte er zum katholischen Glauben gefunden.
»Und dein Vater und deine Brüder?« fragte Mary. »Weißt du, wo sie jetzt sind?«
Ted wußte es nicht, und es interessierte ihn nicht. Die Kirche war sein Zuhause geworden. Lucille hatte er von seinen frühen Jugendjahren nichts erzählt. Er war zweiundzwanzig gewesen, als er sie kennengelernt hatte, zu stolz damals, um über seine beschämende Vergangenheit zu sprechen. Lucille stammte aus einer gutbürgerlichen Familie und war sehr behütet aufgewachsen. Ted hatte sie sehr geliebt und hatte gefürchtet, sie würde nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, wenn er ihr gestand, aus welchen Verhältnissen er kam. Er hatte ihr statt dessen erzählt, die Erziehungsanstalt sei ein Waisenhaus gewesen, aber er hatte fest vorgehabt, ihr später die Wahrheit zu sagen. Aber die Jahre vergingen, und Ted hatte es immer wieder aufgeschoben, und schließlich hatte er den bequemsten Weg gewählt, und seine Vergangenheit einfach vergessen.
Aber mit Gloria hatte er endlich darüber sprechen können. Es war ihm ein dringendes Bedürfnis gewesen, da gerade in den letzten Jahren die Erinnerungen ihn immer häufiger geplagt hatten.
Mary fragte sich, als sie das von ihrem Vater hörte, was kann Gloria dir geben, das Mutter dir nicht geben kann? Und was, fragte sie sich weiter, kann diese Frau dir geben, das ich dir nicht geben kann? Bei dieser Überlegung begriff sie plötzlich, daß ihr Schmerz, als sie von der Beziehung ihres Vaters zu Gloria Renfrow erfahren hatte, nicht ihrer Mutter gegolten hatte, sondern sich selbst. Sie selbst hatte sich als die Betrogene gefühlt.
»Daddy«, sagte sie, »warum ist Mutter so, wie sie ist? Manchmal glaube ich, daß andere ihr wichtiger sind als wir. Immer kümmert sie sich um andere, geht Krankenbesuche machen, sammelt Kleider für die Armen, und für uns hat sie kaum Zeit.«
Ted legte seiner Tochter den Arm um die Schultern. »Vielleicht ist das ihre Art, gute Werke zu tun, um Erlösung von ihren Sünden zu finden.«
»Mutter? Sie sündigt doch nicht!«
»Vielleicht glaubt sie es aber.«
»Daddy, sie trinkt furchtbar viel. Bin ich daran schuld?«
»Nein, sicher nicht. Sie trinkt schon lange, Mary. Sie braucht es. Du hast es nur vorher nicht bemerkt.«
»Warum läßt du dich von ihr rumkommandieren?«
»Wahrscheinlich, weil das der Weg des geringsten Widerstands ist. Ich weiß es selbst nicht genau. Das ist auch etwas, was deine Mutter braucht, und ich lasse es ihr gern. Schau mal, Mary, ich habe meine Mutter nie gekannt. Sie starb, ehe ich alt genug war, um sie richtig kennenzulernen. Danach hatte ich nur meinen Vater und meine Brüder. Und später, im Heim, war ich nur in Gesellschaft der anderen Jungen, der Priester und der Laienlehrer, die alle Männer waren. In meinem Leben fehlten die Frauen, verstehst du? Vielleicht lasse ich mich gern von Frauen beherrschen.«
Ted stand auf und ging zum Barschrank. Er nahm die Flasche, um sein Glas aufzufüllen, und dann stellte er sie wieder weg. Er drehte sich um und sah seine Tochter an.
»Du möchtest wissen, warum ich mich von ihr herumkommandieren lasse? Vielleicht weil ich meinen Frieden gefunden habe, Mary, und gern möchte, daß auch deine Mutter ihren Frieden findet.«
Ted kam zum Sofa zurück und setzte sich wieder zu ihr. Mary sah ihn an und versuchte sich vorzustellen, wie es für ihn gewesen sein mußte, als er vom Priesterseminar weg zur Armee gegangen war und nach seiner Rückkehr aus einem schrecklichen Krieg alle seine Ideale zerstört gesehen hatte.
»Du liebst Gott wirklich, nicht wahr, Daddy?«
»Sagen wir, ich bewundere ihn.«
Sie sprachen noch eine Weile über Christsein, und Mary gestand, daß sie bis zu diesem Abend ihre Mutter für die bessere Katholikin gehalten hatte. Ted antwortete nur mit einem seltsamen Lächeln.
Dann sagte er: »Es ist spät, Kätzchen, und wir müssen morgen früh ins Labor.«
Mary drückte ihren Kopf an seine Schulter und sagt: »Ich habe Angst vor morgen, Daddy .«
19
Die Röntgenassistentin half ihr freundlich lächelnd auf den kalten Stahltisch. Mary klapperte mit den Zähnen, aber sie wußte, daß es nicht an der Temperatur des Raums lag. Ihr war kalt vor Nervosität, nein, schlimmer noch, vor Angst. Sie schloß die Augen, um den gräßlichen Röntgenapparat nicht sehen zu müssen, und bemühte sich, an etwas anderes zu denken.
Als sie vor einer Stunde mit ihren Eltern aus dem Haus gegangen war, hatte sie auf der Treppe ein Päckchen gefunden, das eine handgehäkelte Babygarnitur in Rosa - Mützchen, Jäckchen und winzige Schuhe - enthielt. Und obenauf lag eine Karte von Germaine.
»Mary, es tut mir leid. Bitte sei mir nicht böse. Ich hab dich lieb.«
Sie war ins Haus zurückgelaufen, während ihr Vater den Wagen aus der Garage fuhr, und hatte bei den Masseys angerufen. Germaine war schon auf dem Weg in die Schule gewesen, aber Mary hatte mit ihrer Mutter gesprochen und sie gebeten, Germaine auszurichten, daß sie am Nachmittag noch einmal anrufen würde.
Ein Parfümhauch wehte Mary in die Nase, als die Röntgenassistentin sich über sie beugte, um die Maschine einzustellen.
»Bitte liegen Sie jetzt ganz still.«
»Es ist so unbequem.«
»Ich weiß.«
»Und der Rücken tut mir weh.«
»Nur einen Moment. Es dauert wirklich nicht lange.« Die junge Frau trat hinter einen Schutzschirm. »Halten Sie jetzt bitte den Atem an und bewegen Sie sich nicht.«
Die Maschine knackte, summte, knackte noch einmal, dann trat die junge Frau wieder zu Mary und tauschte die Filmkassetten aus.
»Noch eine von vorn, dann zwei von der Seite«, sagte sie. »Können Sie ein kleines Stück nach rechts rücken?«
Der Papierkittel klaffte hinten auseinander, als Mary sich bewegte, und sie fühlte das eisige Metall an ihrem nackten Rücken.
Die Assistentin ging wieder hinter den Schirm. »Bitte absolut stillhalten jetzt«, sagte sie, und die Maschine fing wieder an, zu knacken und zu summen.
»Okay, jetzt bitte auf die linke Seite. Warten Sie, ich helfe Ihnen.«
Als Mary einige Minuten später aus der Umkleidekabine kam, standen bereits ihre Eltern da.
»Wir fahren gleich hinauf in Dr. Wades Praxis«, sagte Ted, und Mary sah, daß sein Gesicht aschfahl war.
Es würde nicht leicht werden. Es würde vielleicht sogar der schwierigste Moment im Lauf seiner langjährigen ärztlichen Praxis werden. So viel hing vom Befund dieser Aufnahmen ab - nicht zuletzt der Artikel, der zu Hause auf seinem Schreibtisch lag und dem nur noch das letzte Kapitel fehlte. Eine Stunde der Entscheidung. Für alle. Pater Crispin wartete in seinem Haus auf den Befund. Wenn das Ungeborene anen-zephalisch war, würde Jonas dort anrufen müssen. Aber was, wenn ihm nur die Arme oder die Beine fehlten? Was, wenn die Mißbildung nicht solcher Art war, daß sie drastische
Maßnahmen rechtfertigte? Wie sollte er Mary auf eine solche Möglichkeit vorbereiten?
Als die Sprechstundenhilfe die McFarlands in sein Sprechzimmer führte, sah er die angstvolle Besorgnis in ihren Gesichtern, und sie taten ihm leid. Er vergeudete keine Zeit. Sobald die drei sich gesetzt hatten, schaltete er das Gerät ein, in das er zwei Aufnahmen gesteckt hatte - eine Vorderansicht und eine Seitenansicht.
»Das sind die beiden besten Aufnahmen der Serie. Der Fötus ist, wie Sie sehen können, klar umrissen.« Er nahm einen Stift und zeichnete die Umrisse nach. »Hier sehen Sie die Rippen, das Rückgrat, die Arme und die Beine. Das hier -« er zog einen Kreis um eine weißliche Wolke - »ist der Kopf.«
Er senkte den Arm und sah die drei an. »Sie scheint normal zu sein.«
Die beiden Frauen waren sichtlich erleichtert. Lucille nahm die Hand ihrer Tochter und drückte sie. Doch Marys Vater, das sah Jonas deutlich, hatte sich kaum entspannt. Jonas vermutete, daß er ähnliche Befürchtungen hegte wie er selbst.
Jonas Wade hatte erwartet, daß er augenblicklich erleichtert aufatmen würde, wenn sich zeigen sollte, daß der Fötus normal war. Doch nun, da die eine große Angst sich als unbegründet erwiesen hatte, regten sich neue Ängste. Der Fötus sah normal aus, aber Röntgenaufnahmen waren ungenau; sie zeigten weder Hände noch Füße, sie zeigten nicht die Gesichtszüge, nicht den Zustand des Gehirns ...

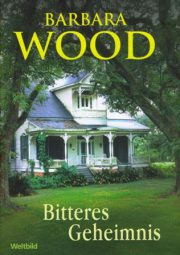
"Bitteres Geheimnis(Childsong)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Bitteres Geheimnis(Childsong)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Bitteres Geheimnis(Childsong)" друзьям в соцсетях.